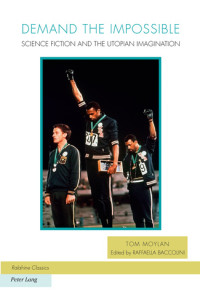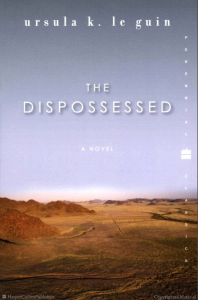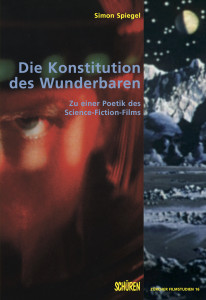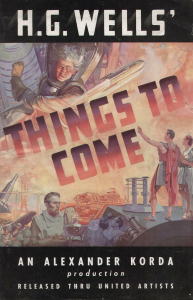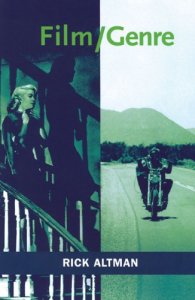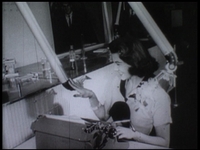Mein aktuelles Forschungsprojekt geht von der Prämisse aus, dass es im Bereich des Spielfilms keine positive Utopien – auch Eutopien genannt – gibt. Die Gründe dafür sind einleuchtend: Die positive Utopie beschreibt eine Gesellschaft ohne Konflikte, die Figuren sind reine Platzhalter und der Handlungsrahmen dient nur als Vorwand für das eigentliche Anliegen: Die detaillierte Beschreibung des utopischen Staates.
So weit ist sich die Forschung mehr oder weniger einig; die meisten Studien zur filmischen Utopie wenden sich deshalb, nachdem sie festgestellt haben, dass es keine untersuchenswerten Eutopien gibt, der Dystopie zu. Ich selber habe anderes vor – ich widme mich positiven Entwürfen im Dokumentar- und Propaganda-Film.
Obwohl mein Forschungsschwerpunkt somit nicht beim Spielfilm liegt, bin ich an diesem Feld dennoch nach wie vor interessiert (wie man auch an diesem Blog sieht). Entsprechend neugierig war ich auf Sebastian Stoppes Unterwegs zu neuen Welten, das ich für das Journal of the Fantastic in the Arts rezensieren durfte. Stoppe widmet sich in seinem Buch dem Star-Trek-Franchise, das er als positive Utopie liest. Dieser Ansatz ist nicht neu – Dominik Orth hat dazu beispielsweise schon einen Aufsatz geschrieben1 – und liegt bis zu einem gewissen Grad auch auf der Hand. Denn zweifellos enthält Star Trek verschiedene utopische Elemente: Die Serien und Filme spielen vor dem Hintergrund einer galaktischen Föderation, in der Menschen und zahlreiche ausserirdische Völker mehr oder weniger friedlich vereint sind. Die Technik ist weit fortgeschritten, die Wirtschaft funktioniert ohne Geld und dank Replikator-Technik gehören Ressource-Probleme weitgehend der Vergangenheit an.
Reichen diese und weitere Elemente nun aber aus, um aus Star Trek als Ganzes eine Utopie zu machen? Die Beantwortung dieser Frage hängt natürlich davon ab, wie eng man den Begriff der Utopie fasst. Bislang war ich der Ansicht, dass Star Trek vom morusschen Modell trotz einiger Gemeinsamkeiten ziemlich weit entfernt ist. Die klassische Utopie in der morusschen Tradition beschreibt seitenlang, wie das politische System, die Wirtschaft, Familie und Erziehung, das Kriegswesen und diverses anderes organisiert ist. Dass kein Spielfilm diese Vollständigkeit auch nur annähernd erreicht, erstaunt nicht. Aber Star Trek ist ja weit mehr als bloss ein Film. Es ist ein Megatext, zu dem neben den Serien und Filmen auch Romane, Comics und offizielle Referenzbücher gehören. Angesichts der Vollständigskeitswut, die sich bei solchen Unternehmen oft beobachten lässt, wäre es durchaus möglich, dass sich genug Material zusammentragen lässt, das in der Summe ein ähnlich komplettes Bild ergibt. Stoppe greift denn auch explizit auf entsprechende kanonisierte – das heisst: durch die Rechteinhaber autorisierte – Bücher zurück.
Gelingt es Stoppe also, den in Star Trek vergrabenen utopischen Entwurf herauszuarbeiten? Mit einem Wort: nein. Auch nach 300 Seiten war zumindest für mich nach wie vor nicht klar, warum Star Trek nun eher als Utopie gelten sollte als diverse andere Space Operas. Dass es utopische Elemente in der Franchise gibt, ist unbestritten, diese machen Star Trek als Ganzes aber noch nicht zur Utopie. Zumal sich Stoppe am Idealtypus Utopia orientiert und somit von einem ähnlich engen Utopie-Begriff wie ich ausgeht. Es gibt zwar durchaus Gemeinsamkeiten, die blosse Tatsache, dass zum Beispiel sowohl Utopia als auch Star Trek ohne Geld auskommen, ist aber noch kein starkes Argument. Denn bei Morus erhalten wir Ausführungen, wie diese fiktive Wirtschaft funktionieren soll, bei Star Trek dagegen wird nichts erklärt resp. bleiben die Ausführungen recht wolkig. Dies gilt auch für eines der wichtigsten Elemente jeder Utopie – der Staatsorganisation. Stoppe kann auch nach ausführlicher Analyse nicht darlegen, wie das politische System von Star Trek aufgebaut ist und in welchem Verhältnis die verschiedenen Institutionen – so sie denn überhaupt bekannt sind – zu einander stehen. Dass dies so ist, überrascht freilich nicht. Zum einen geht es bei Star Trek in erster Linie eben nicht um die Darlegung eines utopischen Entwurfs, zum anderen wäre es für die Autoren des Franchise wohl eine unnötige Einschränkung, wenn all diese Dinge genau festgelegt wären. Die Vagheit des Entwurfs dürfte hier bis zu einem gewissen Grad gewollt sein, denn sie schafft Spielraum.
Nicht nur bin ich mit Stoppes Fazit nicht einverstanden, es gibt noch weitere Dinge, die mich an seiner Studie, die als Dissertation an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg entstanden ist, irritieren. So gibt es mindestens drei umfangreiche deutschsprachige Studien zur filmischen Utopie2 – Stoppe erwähnt keine davon. Fast noch seltsamer ist, wie viel Zeit der Autor damit verbringt, das Star-Trek-Universum vorzustellen – mit allen Quadranten, Rassen, Raumschiffen etc. In diesen Ausführungen erinnert sein Buch eher an ein Fan-Kompendium als an eine wissenschaftliche Studie. Zumal ein Grossteil dieser Ausführungen kaum etwas zum eigentlichen Thema beiträgt. Indem er auf die verschiedenen Allianzen und Konflikte eingeht, will Stoppe zeigen, dass Politik ein wichtiger Faktor in Star Trek ist. Wenn das allerdings bereits utopisch ist, müsste auch Game of Thrones als Utopie gelten.
Für mich hat Unterwegs zu neuen Welten letztlich nur bestätigt, dass Star Trek trotz einzelner utopischer Elemente insgesamt nicht als positive Utopie gelten kann.
Meine «offizielle» Rezension wird in einer der kommenden Ausgaben des Journal of the Fantastic in the Arts erscheinen.
Update: Die Rezension ist mittlerweile erschienen und hier verfügbar.
Stoppe, Sebastian: Unterwegs zu neuen Welten. Star Trek als politische Utopie. Darmstadt: büchner 2014.
Bei Amazon kaufen.
- Orth, Dominik: «Mediale Zukunft — Die Erreichbarkeit des (Anti-)Utopischen». In: Medienobservationen, 2008. http://www.medienobservationen.lmu.de/artikel/kino/ kino_pdf/orth_zukunft.pdf[↩]
- Zirnstein, Chloé: Zwischen Fakt und Fiktion. Die politische Utopie im Film. München: Utz, 2006; Müller, André: Film und Utopie. Positionen des fiktionalen Films zwischen Gattungstraditionen und gesellschaftlichen Zukunftsdiskursen. Berlin: Lit, 2010; Endter, Heike: Ökonomische Utopien und ihre visuelle Umsetzung in Science-Fiction-Filmen. Nürnberg: Verlag für moderne Kunst Nürnberg, 2011.[↩]