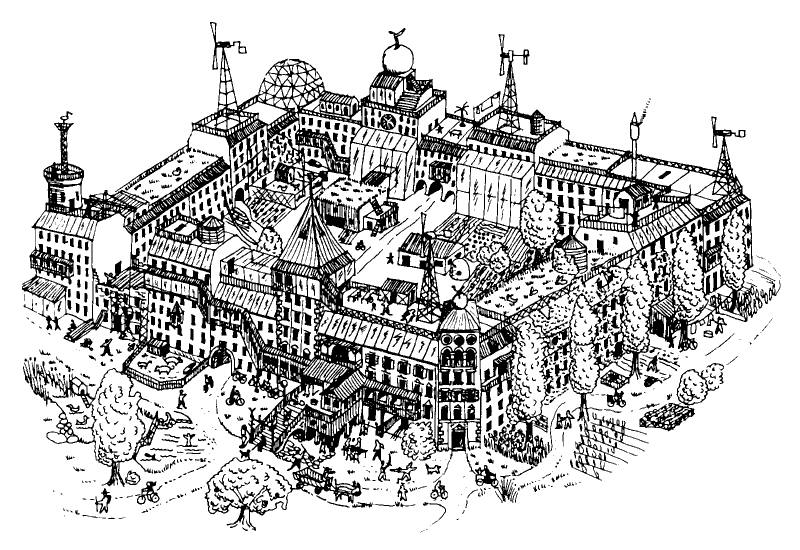Ich würde mich nicht als Star-Wars-Experte und schon gar nicht als Fan des Franchise bezeichnen. Dieser Umstand hat die NZZ am Sonntag aber nicht davon abgehalten, mich anlässlich des Kinostarts von Star Wars: The Rise of Skywalker zu interviewen. Sonderlich tiefe Einsichten gebe ich nicht von mir, aber wenn’s interessiert, dar kann das Interview hier lesen (je nachdem hinter einer Paywall oder nicht).
Archiv für den Monat: Dezember 2019
Die Utopie ist noch nicht tot
Das Genre der Utopie-Totenrede erfreut sich im deutschsprachigen Feuilleton schon seit geraumer Zeit grosser Beliebtheit. Mein folgender Gastbeitrag im Tages-Anzeiger ist eine indirekte Antwort auf einen Artikel von Beat Metzler.
Die Klage, dass Dystopien überhand- nehmen, ist ein Dauerbrenner des Feuilletons. Alle paar Monate lesen wir, wie allgegenwärtig der Pessimismus in Literatur und Film sei. Dass die Gegenwart angesichts von Klimawandel, Kriegen, Finanz- und Flüchtlingskrisen nicht rosig ist, darin sind sich alle einig. Aber statt aus Utopien Hoffnung zu schöpfen, ergötzen wir uns an Dystopien, die uns stets von neuem versichern, dass die Zukunft noch viel schrecklicher sein wird.
Die Diagnose scheint angesichts des Erfolgs von Produktionen wie der Hunger Games-Reihe oder The Handmaid’s Tale treffend, beruht aber auf falschen Prämissen.
Seit der englische Humanist Thomas Morus 1516 seine Utopia veröffentlicht und damit das Genre begründet hat, machte die Utopie viele Wandlungen durch. Was sich dabei kaum verändert hat, ist ihre zentrale Funktion: Die Utopie zeigt, dass es Alternativen zur misslichen Gegenwart gibt. Ihr Ausgangspunkt ist immer der Befund, dass die Lage desolat ist; die Kritik am Status quo ist dabei oft wichtiger als der utopische Gegenentwurf. Sonderlich optimistisch ist das nicht.
Wirklich ausgestorben ist diese Form nie. Was sich verändert hat, ist das Interesse des Publikums. Edward Bellamys Looking Backward, das ein sozialistisches Boston im Jahr 2000 entwirft, war Ende des 19. Jahrhunderts in den USA ein Millionenbestseller; 130 Jahre später ist das Buch ausserhalb von Spezialistenkreisen unbekannt.
Nicht anders erging es Aldous Huxley mit seinem letzten Roman, dem 1962 erschienenen Island. Auf der Insel Pala lebt eine kleine Population dank Meditation, frei gelebter Sexualität und gezieltem Einsatz der fiktiven Droge Moksha ein Leben in Glück und Harmonie. Huxleys Utopie ist heute praktisch vergessen, geblieben ist dagegen seine drei Jahrzehnte früher entstandene Dystopie Brave New World.
Ähnlich das Bild, wenn wir uns in heimatliche Gefilde begeben. Einer der radikalsten utopischen Entwürfe jüngeren Datums dürfte bolo’bolo des Zürcher Autors P. M. sein. Bei P. M. ist jegliche staatliche Organisation aufgehoben, sind die Menschen in Gemeinschaften von maximal 500 Mitgliedern, den sogenannten bolos, organisiert. Die Regeln des Zusammenlebens gibt sich jedes bolo selbst, vom egalitären bis zum totalitären bolo ist alles möglich. bolo’bolo wird gerne als Kultbuch bezeichnet, ausser einer Handvoll eingefleischter Anarchisten dürfte es aber kaum jemand wirklich gelesen haben.
Anders, als gerne suggeriert wird, ist die Dystopie keine neue Erscheinung. In der Science-Fiction dominieren schon lange negative Zukunftsentwürfe. Das liegt weniger am chronischen Pessimismus der Autoren, sondern daran, dass Geschichten Konflikte brauchen. Eine Welt, in der alle zufrieden sind, ist eine denkbar schlechte Ausgangslage für eine spannende Erzählung. Dystopien sind nicht zuletzt deshalb so beliebt, weil sie den Konflikt frei Haus mitliefern. In ihrem Zentrum steht fast immer die Rebellion eines Unangepassten, Action und Nervenkitzel sind damit garantiert.
Dabei sind Dystopien gar nicht so pessimistisch wie oft behauptet, denn an ihrem Ende steht meist der Umsturz der tyrannischen Ordnung, leuchtet ein utopischer Horizont auf. Wie der Liebesroman, der endet, wenn die Liebenden endlich vereint sind, schliesst auch die Dystopie in dem Moment, in dem das Glück greifbar wird.
Ohnehin sagt die Allgegenwart von Dystopien weniger über den Zeitgeist als über die Strategien der Filmindustrie aus. Science-Fiction ist heute kein Billiggenre mehr, sondern bildet eine zentrale Säule in Hollywoods Geschäftsmodell. Wer sich vor 30 Jahren nicht für das Genre interessierte, konnte ihm leicht aus dem Weg gehen und somit auch übersehen, wie häufig Dystopien bereits damals waren. Eine Serie wie The Handmaid’s Tale ist dagegen ein aufwendig produziertes Prestigeprojekt, das auf allen Kanälen beworben und im Feuilleton diskutiert wird. Einmal mehr gilt: Es liegt nicht am Angebot, sondern daran, was wir konsumieren.
Erschienen im Tages-Anzeiger vom 12. Dezember von 2019.
Das wahre Wesen der Welt
Verschwörungstheorien sind zwar keinesfalls der Fokus meiner bisherigen Forschung, aber bei meiner Beschäftigung mit utopischen Filmen – insbesondere den Zeitgeist-Filmen – kam ich nicht an dem Thema vorbei. Deshalb habe ich auch nicht lange gezögert, ein Proposal für die Tagung Mit Fiktionen über Fakten streiten. Fake News, Verschwörungstheorien und ihre kulturelle Aushandlung, die vom 28.–30.11.2019 an der der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg stattfand, einzureichen.
Die von Vera Podskalsky und Deborah Wolf organisierte Tagung war sehr gelungen. Mir wurde wieder einmal klar, dass es sich lohnt, wenn zwischendurch die eigene Fach- bzw. Themenblase verlässt.