Erschienen im Quarber Merkur 116.
Genres sind seltsame Gebilde. Als Kinogänger oder Leser verknüpfen wir Erwartungen mit ihnen, die von den jeweiligen Werken in der Regel auch erfüllt werden. Genres sind somit sowohl für die Produktion als auch die Rezeption von fundamentaler Bedeutung, was eigentlich nahelegen würde, dass dem Konzept auch in der Wissenschaft eine zentrale Funktion zukommen müsste.
In der Realität ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Genres aber von einem eigenartigen Widerspruch geprägt. Auf der einen Seite gibt es die Genretheorie, die versucht, dem Phänomen auf konzeptioneller Ebene gerecht zu werden. Grundlegende Frage ist hier, was Genres eigentlich sind resp. wie sie sich historisch konstituieren. Obwohl die Schwerpunkte in Film- und Literaturwissenschaft nicht deckungsgleich sind, hat sich mittlerweile beiderorts die Erkenntnis durchgesetzt, dass Genres nicht als abstrakte Entitäten existieren, sondern im Gebrauch entstehen und sich verändern. Genres sind nicht objektiv in ein Werk eingeschrieben, sondern diskursive Begriffe, welche von ihren »Nutzern« geprägt werden. Je nach Benutzergruppe können sich Genrebezeichnungen und -konzeptionen deshalb stark unterscheiden. Ein Kinogänger der 1930er Jahre hatte andere Erwartungen an einen Western als ein zeitgenössischer Zuschauer, und während ein SF-Fan mit dem Begriff »Steampunk« bestimmte Motive und Plot-Elemente assoziiert, dürfte sich ein in der SF nicht bewanderter Leser gar nichts darunter vorstellen.

Was ist ein typischer Western? John Wayne in John Fords Stagecoach (1939).
Insbesondere in der Filmtheorie ist man deshalb schon seit Längerem von der Vorstellung abgerückt, Genres ließen sich in irgendeiner Weise als abstraktes, in sich logisches System modellieren. Genretheoretiker wie Rick Altman oder Steve Neale verstehen Genres vielmehr als pragmatische und multidiskursive Begriffe, die nur im konkreten Gebrauch sinnvoll analysiert werden können. Das bedeutet auch, dass sich die Wissenschaft nicht auf die (film)textliche Untersuchung einzelner Werke beschränken kann, sondern ebenso den Entstehungs- und Rezeptionskontext in Betracht ziehen muss. Vor welchem Hintergrund entsteht ein Werk, wie wird es vermarktet und rezipiert, inwieweit reagiert es auf bereits bestehende Werke und provoziert seinerseits – Stichwort Intertextualität – Reaktionen etc.? Genretheorie wird somit zur Genregeschichte.
Eine derartige Genreanalyse ist nicht nur äußerst aufwändig, sondern auch zwangsläufig begrenzt und stets nur vorläufig. Dies mag erklären, warum sich die Erkenntnisse der Genretheorie bislang kaum in der »praktischen« wissenschaftlichen Arbeit niedergeschlagen haben. Zwar hat die Theorie hoch elaborierte Modelle zur Beschreibung ihres Gegenstands entwickelt, die meisten Genrestudien scheren sich darum aber keinen Deut. Stattdessen werden Genres vielerorts nach wie vor als textlich fixierbare Gebilde betrachtet, und Genregeschichte nimmt nicht selten die Form einer teleologischen Erzählung an, in deren Verlauf sich ein Genre von seiner Rohform hin zum Meisterwerk verfeinert, um dann anschließend zu degenerieren. Untersuchungen, welche die Erkenntnisse der Theorie ernst nehmen und Genres in ihrer ganzen Vielschichtigkeit beschreiben, sind nach wie vor rar.
Sonja Schmids Studie Im Netz der Filmgenres erscheint da als erfreuliche Ausnahme. Das Buch, das auf Schmids Dissertation an der Universität Bayreuth zurückgeht, versteht sich explizit als »Plädoyer für eine vernetzte Genregeschichtsschreibung« und begreift Genres als »intertextuelle Schaltstellen« (13). Anhand von Peter Jacksons The-Lord-of the-Rings-Trilogie (NZ/USA 2001–2003) und deren Bedeutung für die Fantasy will Schmid »die vielfältigen Prozesse und Dynamiken aufzeigen, die sowohl auf diachroner wie synchroner Ebene zu der Entstehung des […] Werks beigetragen haben und damit maßgeblich auch die Weiterentwicklung des Fantasy-Genres als solches beeinflusst haben« (16).

Der Ansatz ist somit klar und lobenswert, die Umsetzung kann allerdings nicht vollständig überzeugen. An Schmids Studie lässt sich ein Phänomen beobachten, das für Dissertationen – insbesondere für deutschsprachige – typisch ist: Ein massiver Theorieüberhang. Das liegt zum einen daran, dass die deutschsprachigen Geisteswissenschaften traditionell mehr an Theorie und Systematisierung interessiert sind als die angelsächsischen. Es hängt aber auch mit der besonderen Textform Dissertation zusammen. Eine Dissertation ist typischerweise die erste wissenschaftliche Arbeit, in die man sich als angehender Akademiker so richtig vergräbt. Es ist ganz natürlich, dass man all die Zeit, die man mit Recherchen verbracht hat, am Ende in textlicher Form sichtbar machen will. Zugleich gehört es zu den Spielregeln einer Dissertation, dass man fortlaufend unter Beweis stellt, wie gut man sein Gebiet kennt. Es ist eine große Herausforderung, genug Abstand von seinem Gegenstand zu gewinnen, um abzuschätzen, was für einen potenziellen Leser tatsächlich relevant sein könnte. Oft glückt dies nicht ganz, weshalb viele Dissertationen mit einem überlangen Theorieteil aufwarten, in dem ausführlich Detailfragen diskutiert werden, die für die eigentliche Untersuchung kaum Relevanz besitzen.
Im Netz der Filmgenres ist hierfür exemplarisch: Von den knapp 250 Seiten Text entfallen rund hundert auf eine Diskussion des Genrekonzepts und dem als New Film History bezeichneten Ansatz der Geschichtsschreibung, dem Schmid folgt. Es gibt hier auch einige inhaltliche Schnitzer – so behauptet Schmid, Tzvetan Todorov verlagere in seiner Phantastiktheorie die »Genrefrage in den Rezipienten« (24), was schlicht falsch ist. Auch Schmids Gebrauch des Begriffs ›Prototypenmodell‹ ist ungewohnt; normalerweise wird damit ein aus der kognitiven Psychologie resp. Linguistik stammendes Konzept bezeichnet. Unter Prototyp wird dabei ein mentales Konstrukt verstanden, das einen typischen Vertreter einer bestimmten Kategorie darstellt. Schmid meint mit Prototypenmodell dagegen einen an Northrop Frye angelehntes Archetypen-Ansatz. Zwar macht sie auf den Bedeutungsunterschied aufmerksam (27, Anm. 37), im Kontext der Genretheorie ist diese Nomenklatur aber ungewohnt. Im Großen und Ganzen sind Schmids Ausführungen allerdings korrekt und gut nachvollziehbar, sie fallen einfach viel zu umfangreich aus, denn worauf die Autorin hinauswill, ist eigentlich von Beginn an klar,
Schmid kennt ihren Gegenstand und die relevante Fachliteratur, ihre Stärke liegt aber nicht darin, das Gelesene zu synthetisieren. Dies ändert sich auch im dritten Teil nicht, in dem sie schließlich auf das Fantasy-Genre zu sprechen kommt. Inhaltlich gibt es hier ebenfalls Unstimmigkeiten, etwa die Aussage, der Phantastik-Forscher Uwe Durst beschäftige sich primär mit Fantasy (140, Anm. 406), oder die Behauptung, der Begriff »Fantasy« habe sich erst in den 1980er Jahren im Zusammenhang mit Filmen wie Excalibur (John Boorman. USA 1981) und Time Bandits (Terry Gilliam. GB 1981) durchgesetzt (119). Für Stirnrunzeln sorgt auch eine Fußnote zum Merchandising von Star Wars. Nach Schmid hat das Franchise über diesen Vermarktungskanal 20 Millionen Dollar eingebracht (184, Anm. 545), obwohl selbst die von ihr angeführte Quelle von mehr als 22 Milliarden Dollar spricht. Trotz solcher offensichtlicher Flüchtigkeitsfehler ist aber das eigentliche Problem, dass die Autorin fast nur Bestehendes referiert.

John Boormans Excalibur – hat dieser Film wirklich den Begriff ‹Fantasy› populär gemacht?
Nach gut 170 Seiten Vorarbeit kommt das Buch dann endlich bei der Hauptsache an, bei Peter Jacksons Trilogie. Im Folgenden wird ein ganzer Katalog von relevanten Perspektiven durchgearbeitet: Lord of the Rings als typischer Vertreter des Fantasy-Genres, technische, wirtschaftliche und sozio-historische Aspekte sowie intertextuelle und intermediale Bezüge. Schmids Ausführungen zum Realitätseindruck von Lord of the Rings, der Figurengestaltung und dem Marketing ist grundsätzlich zuzustimmen, aber irgendwie wird nie recht ersichtlich, wozu der ganze vorangegangene theoretische Aufwand nötig war. Schmid betont zurecht, dass »es eines Blickes auf die vielfältigen Diskurse, die an der Produktion des Werkes beteiligt sind« (254) bedarf, um dieses adäquat in der Geschichte des Genres einzuordnen. Aber obwohl immer wieder von Netzwerken und Querbezügen die Rede ist, bleibt das Vorgehen weitgehend additiv.
Das Kapitel »The The Lord of the Rings im multidiskursiven Netzwerk der generic user[sic!]«, das eigentlich das Zentrum der Untersuchung bilden müsste, fällt inhaltlich besonders schwach aus. Auf die empirische Fanforschung, die just in diesem Bereich einiges zu bieten hätte, nimmt Schmid kaum Bezug. Die Ausführungen zu CGI und wirtschaftlichen Aspekten wiederum sind oberflächlich, der Abschnitt zu NS-Bezügen geradezu hanebüchen; Schmid verquickt hier die Interpretation von Tolkiens Trilogie als Allegorie auf den Zweiten Weltkrieg – eine Leseweise, gegen die sich der Autor stets gewehrt hat – mit der Frage, inwieweit Jackson sich an die Ikonographie von NS-Propagandafilmen anlehnt. Zwei Dinge, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben.
Obwohl das als Hardcover erschienene Buch auf den ersten Blick ansprechend daherkommt, entpuppt es sich bei genauerer Lektüre als eher unsorgfältig gemacht. Es wimmelt von kleineren bis mittleren typographischen, sprachlichen und inhaltlichen Fehlern. Besonders auffallend ist eine seltsam verzerrte Zeitwahrnehmung der Autorin: So wird Robin Woods 1979 erschienene Essaysammlung American Nightmare zitiert, um »jüngere Tendenzen im Horrorgenre« (202, Anm. 592) zu charakterisieren, obwohl zwischen den Filmen, die Wood beschreibt, und Jacksons Trilogie gut 30 Jahre liegen. Dazu passt, dass Schmid die Ära des New Hollywood, deren Beginn normalerweise Ende der 1960er Jahre angesetzt wird, in die 1990er Jahre verlagert. Die Einschätzung, Jacksons Glück sei gewesen, dass die CGI-Technologie »eben erst« (217) ihren Durchbruch erlebt habe – nämlich mit Jurassic Park (Steven Spielberg. USA 1993) –, zeugt ebenfalls von einem seltsamen Zeitverständnis, liegen zwischen den beiden Filmen doch fast zehn Jahre.
All diese Fehler wären zu verschmerzen, würde Schmid mit genuin interessanten Einsichten aufwarten. Insgesamt überwiegt aber der Eindruck »viel Aufwand, wenig Ertrag«. Als Beispiel für die Fruchtbarkeit eines modernen genretheoretischen Ansatzes taugt Im Netz der Filmgenres somit nur begrenzt.
Schmid, Sonja: Im Netz der Filmgenres. The Lord of the Rings und die Geschichtsschreibung des Fantasygenres. Tectum-Verlag: Marburg 2014, 294 Seiten, Hardcover, 29,95€. Bei Amazon erhältlich.
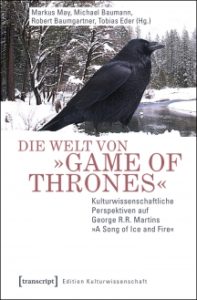 Mit Fantasy habe ich eigentlich wenig am Hut. Lord of the Rings habe ich vor Jahren gelesen, ohne dass es grossen Eindruck auf mich gemacht hätte, Harry Potter hat mich nach dem dritten Band nicht mehr sonderlich interessiert, und die neueren Fantasy-Blockbuster schaue ich mir – wenn überhaupt – eher aus Pflichtgefühl, denn aus genuinem Interesse an. Eine grosse Ausnahme bildet aber die Fernsehserie Game of Thrones, die mich restlos begeistert (ok, nicht völlig restlos. Staffel 5 und 6 konnten nicht ganz an die vorangegangenen Höhepunkte anschliessen).
Mit Fantasy habe ich eigentlich wenig am Hut. Lord of the Rings habe ich vor Jahren gelesen, ohne dass es grossen Eindruck auf mich gemacht hätte, Harry Potter hat mich nach dem dritten Band nicht mehr sonderlich interessiert, und die neueren Fantasy-Blockbuster schaue ich mir – wenn überhaupt – eher aus Pflichtgefühl, denn aus genuinem Interesse an. Eine grosse Ausnahme bildet aber die Fernsehserie Game of Thrones, die mich restlos begeistert (ok, nicht völlig restlos. Staffel 5 und 6 konnten nicht ganz an die vorangegangenen Höhepunkte anschliessen).



