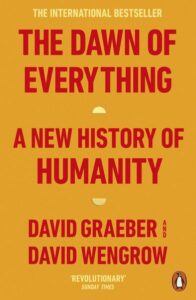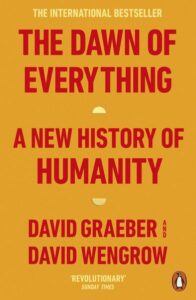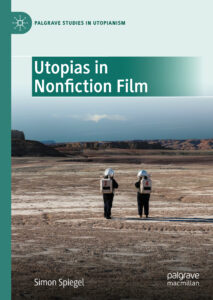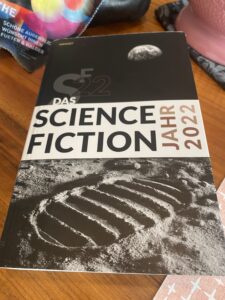Vergangenes Jahr habe ich darauf verzichtet, doch dieses Mal gibt es wieder die Statistik, die niemand braucht – eine Auflistung, was ich im vergangenen Jahr so gelesen und geschaut habe. Nicht aufgeführt sind Serien, über die ich nicht Buch führe, sowie eine Reihe von Kurzfilmen.
Filmische Premieren
Gemäss Letterboxd habe ich 2022 142 Filme zum ersten Mal gesehen. Eine wesentlichen Anteil bilden dabei Animationsfilme, die ich als Vorbereitung zu einer Vorlesung zur Geschichte des Animationsfilms schaute, die ich im Sommmersemester hielt (wobei diese Liste nicht vollständig sein dürfte). Ein weiterer grösserer Block bilden die Filme, die ich mir als Jurymitglied an der Duibsurger Filmwoche zu Gemüte führen durfte. Insbesondere unter den Animationsfilmen gab es zahlreiche Highlights (z.B. mehr oder weniger alles von Winsor McCay, Len Lyle und Norman McLaren), aber auch einige Enttäuschungen. So erwiesen sich sowohl La planète sauvage als auch Fritz the Cat, zwei Filme, denen ich immer wieder begegnet bin, bisher aber nie vollständig gesehen habe, als, sagen wir mal, mässig gut gealtert.

Everything Everywhere All At Once
Zwar war ich auch 2022 nicht so oft im Kino, wie ich es mir gewünscht hätte, insgesamt war die Ausbeute bei den neuen Produktionen aber gar nicht schlecht. Es ist sicher keine originelle Feststellung, wenn ich sage, dass der Film des Jahres für mich unbestritten Everything Everywhere All at Once ist. Damit meine ich nicht, dass er unbedingt mein Lieblingsfilm des Jahres ist, sondern dass er für mich – und mit dieser Einschätzung bin ich beileibe nicht allein – beispielhaft dafür steht, was derzeit im anspruchsvollen Mainstream-Kino möglich ist. Everything Everywhere All at Once ist ein vollkommen überdrehter Film, der geradezu platzt vor Ideen und in beeindruckender Weise absurden Humor mit einer sehr berührenden und im Grunde auch sehr geerdeten Geschichte verbindet. So sieht zeitgemässes Erzählen aus, so verbindet man Science Fiction und Popkukltur mit relevanten gesellschaftlichen Themen, so erzählt man eine Geschichte mit einem diversen Cast. Und nicht zuletzt: So nutzt man die Idee des Multiversums auf erzählerisch interessante Weise.
Weitere Highlights sind die österreichische Produktion The Trouble with Being Born von Sandra Wollner, eine verstörende Mischung aus Ex Machina und Under the Skin, sowie Unrueh, der Zweitling des Schweizer Regisseurs Cyril Schäublin. So unterschiedlich diese beiden Filme sind, sind es beides Werke von jungen Filmschaffenden, die sich durch beeindruckende formale Konsequenz auszeichnen.

The Trouble with Being Born
Hier die Liste in alphabetischer Reihenfolge:
10 Things I Hate About You. Gil Junger, 1999.
Alice. Jan Švankmajer, 1988.
An American March. Oskar Fischinger, 1941.
Animal Farm. John Halas, 1954.
Annette. Leos Carax, 2021.
Armageddon Time. James Gray, 2022.
Avatar: The Way of Water. James Cameron, 2022.
Back Alley Oproar. Friz Freleng, 1948.
Barbarian. Zach Cregger, 2022.
Becoming Astrid. Pernille Fischer Christensen, 2018.
Benedikt. Katrin Memmer, 2022.
The Birth of the Robot. Len Lye, 1936.
The Black Phone. Scott Derrickson, 2021.
Boiling Point. Philip Barantini, 2021.
Bubbles. Dave Fleischer, 1922.
The Cameraman’s Revenge. Wladyslaw Starewicz, 1912.
Cape Fear. Martin Scorsese, 1991.
Castle of Otranto. Jan Švankmajer, 1977.
Le cauchemar de Fantoche. Émile Cohl, 1908.
A Chairy Tale. Norman McLaren/Claude Jutra, 1957.
Color Cry. Len Lye, 1952.
A Colour Box. Len Lye, 1935.
Colour Flight. Len Lye, 1937.
The Death of Stalinism in Bohemia. Jan Švankmajer, 1991.
Der Conny ihr Pony. Martin Hentze, 2009.
Deserter. Vsevolod Pudovkin, 1933.
Despicable Me 3. Kyle Balda, 2017.
Dimensions of Dialogue. Jan Švankmajer, 1983.
Diva. Nicolas Cilins, 2022.
Drei Frauen. Maksym Melnyk, 2022.
The Dunes Said. Maya Connors, 2021.
The Enchanted Drawing. J. Stuart Blackton, 1900.
Everything Everywhere All at Once. Daniel Scheinert, 2022.
Fantasmagorie. Émile Cohl, 1908.
Feline Follies. Otto Messmer, 1919.
Felix in Hollywood. Otto Messmer, 1923.
Felix in the Swim. Otto Messmer, 1922.
Felix Saves the Day. Otto Messmer, 1922.
Flee. Jonas Poher Rasmussen, 2021.
Flora. Jan Švankmajer, 1989.
Fotel/The Chair. Daniel Szczechura, 1963.
Free Guy. Shawn Levy, 2021.
Free Radicals. Len Lye, 1958.
Fritz the Cat. Ralph Bakshi, 1972.
Fun in a Bakery Shop. Edwin S. Porter, 1902.
Genesis 2.0. Christian Frei, 2018.
Gertie the Dinosaur. Winsor McCay, 1914.
Ghost Fair Trade. Cheikh Ndiaye, 2022.
Gladbeck. Volker Heise, 2022.
Glass Onion: A Knives Out Mystery. Rian Johnson, 2022.
Die goldene Gans. Lotte Reiniger, 1944.
The Good Liar. Bill Condon, 2019.
The Gray Man. Anthony Russo, 2022.
Gulliver’s Travels. Dave Fleischer, 1939.
Hands of Steel. Sergio Martino, 1986.
The High Frontier: The Untold Story of Gerard K. O’Neill. Ryan Stuit, 2021.
High Note. Chuck Jones, 1960.
Horse/Kon. Witold Giersz, 1967.
Hotel Sinestra. Michiel ten Horn, 2022.
House of Gucci. Ridley Scott, 2021.
Humorous Phases of Funny Faces. J. Stuart Blackton, 1906.
I‘Tikaaf. Anna-Maria Dutoit, 2022.
Interdit aux chiens et aux Italiens. Alain Ughetto, 2022.
Jabberwocky. Jan Švankmajer, 1971.
Kaleidoscope. Len Lye, 1935.
Kayu Besi. Max Sänger, 2022.
Klatki/Cages. Mirosław Kijowicz, 1967.
Komposition in Blau. Oskar Fischinger, 1935.
Krazy Kat Goes A-Wooing. George Herriman, 1916.
Krazy Kat, Bugologist. 1916.
Leonardo’s Diary. Jan Švankmajer, 1972.
Lina. Mike Schaerer, 2016.
Linear Dreams. Richard Reeves, 1997.
Little Nemo. Winsor McCay, 1911.
Lotte Reiniger – Tanz der Schatten. Rada Bieberstein, 2012.
The Loveless. Kathryn Bigelow, 1981.
Manhunter. Michael Mann, 1986.
The Matrix Resurrections. Lana Wachowski, 2021.
Meat Love. Jan Švankmajer, 1989.
The Mechanical Monsters. Dave Fleischer, 1941.
Men. Alex Garland, 2022.
The Menu. Mark Mylod, 2022.
The Merry Circus/Vesely Cirkus. Jiří Trnka, 1951.
Minions: The Rise of Gru. Kyle Balda, 2022.
Moonage Daydream. Brett Morgen, 2022.
Mosaic. Evelyn Lambart, 1965.
The Mule. Clint Eastwood, 2018.
Muratti greift ein. Oskar Fischinger, 1934.
La musicomanie. Émile Cohl, 1910.
Nakskov 1:50. Matilda Mester, 2022.
Near Dark. Kathryn Bigelow, 1987.
Nest. Hlynur Pálmason, 2022.
The New Car. Ub Iwerks, 1931.
New Nightmare. Wes Craven, 1994.
Nope. Jordan Peele, 2022.
Old. M. Night Shyamalan, 2021.
Oxygen. Alexandre Aja, 2021.
Particles in Space. Len Lye, 1980.
Peter von Kant. François Ozon, 2022.
Le petit Nicolas: Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?. Amandine Fredon/Benjamin Massoubre, 2022.
Pigs in a Polka. Friz Freleng, 1943.
La planète sauvage
Policy and Pie. Gregory La Cava, 1918.
Prey. Dan Trachtenberg, 2022.
Punch and Judy. Jan Švankmajer, 1966.
The Purge: Election Year. James DeMonaco, 2016.
Rabbit of Seville. Chuck Jones, 1950.
Rainbow Dance. Len Lye, 1936.
Le retapeur de cervelles. Émile Cohl, 1911.
Die Seilbahn. Claudius Gentinetta, 2008.
Sherlock, Jr.. Buster Keaton, 1924.
Shocking Dark. Bruno Mattei, 1989.
Sleep Dealer. Alex Rivera, 2008.
Sonne unter Tage. Alex Gerbaulet, Mareike Bernien, 2022.
The Souvenir. Joanna Hogg, 2019.
Spiel mit Steinen/Hra s kameny. Jan Švankmajer, 1965.
The Stolen Airship/Ukradená vzducholod. Karel Zeman, 1967.
Story of the Bass Cello/Román s basou. Jiří Trnka, 1949.
Stratos-Fear. Ub Iwerks, 1933.
Studie Nr. 8. Oskar Fischinger, 1931.
Superman: The Mad Scientist. Dave Fleischer, 1941.
Taken 2. Olivier Megaton, 2012.
Tara. Volker Sattel, 2022.
Three Songs About Lenin. Dziga Vertov, 1934.
Ticket to Paradise. Ol Parker, 2022.
To Spring. William Hanna, 1936.
Top Gun: Maverick. Joseph Kosinski, 2022.
Triangle of Sadness. Ruben Östlund, 2022.
The Trouble with Being Born. Sandra Wollner, 2020.
The Two Mouseketeers. Joseph Barbera, 1952.
Unrueh. Cyril Schäublin, 2022.
Vera. Tizza Covi, 2022.
Volunteer. Anna Thommen(Lorenz Nufer, 2019.
Wenn’s Leben beginnt. Gabriel Monthaler, 2022.
What Remains On The Way. Danilo Do Carmo, 2021.
What’s Opera, Doc?. Chuck Jones, 1957.
Yellow Submarine. George Dunning, 1968.
Yesterday. Danny Boyle, 2019.
Youth Topia. Dennis Stormer, 2021.
Zig Zag. Georges Schwizgebel, 1996.
Zusammenleben. Thomas Fürhapter, 2022.
Zweisamkeit. Lilian Sassanelli, 2022.

Unrueh
Reprisen
Im Vergleich zu früheren Jahren habe ich relativ wenig Filme wiedergeschaut – insgesamt 41. Es ist die übliche Mischung aus Filmen, die ich aus wissenschaftlichen Gründen schaue, und solchen, die zur Bildung des Nachwuchses dienen.
Alexander Nevsky. Sergei Eisenstein, 1938.
The Birds. Alfred Hitchcock, 1963.
Blue Steel. Kathryn Bigelow, 1990.
Brainstorm. Douglas Trumbull, 1983.
Charlie and the Chocolate Factory. Tim Burton, 2005.
Chinatown. Roman Polanski, 1974.
Collateral. Michael Mann, 2004.
Dene wos guet geit. Cyril Schäublin, 2017.
Detention. Joseph Kahn, 2011.
Diamonds Are Forever. Guy Hamilton, 1971.
Dreamscape. Joseph Ruben, 1984.
Duck Soup. Leo McCarey, 1933.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Michel Gondry, 2004.
Goldfinger. Guy Hamilton, 1964.
Hannibal. Ridley Scott, 2001.
Heat. Michael Mann, 1995.
Indiana Jones and the Last Crusade. Steven Spielberg, 1989.
Inside Man. Spike Lee, 2006.
Kill Bill: Vol. 1. Quentin Tarantino, 2003.
Ladybird Ladybird. Ken Loach, 1994.
Lava. James Ford Murphy, 2014.
The Little Witch. Michael Schaerer, 2018.
The Maltese Falcon. John Huston, 1941.
The Mask. Chuck Russell, 1994.
Nelly’s Folly. Chuck Jones, 1961.
Pleasantville. Gary Ross, 1998.
Promising Young Woman. Emerald Fennell, 2020.
Raiders of the Lost Ark. Steven Spielberg, 1981.
Shutter Island. Martin Scorsese, 2010.
The Silence of the Lambs. Jonathan Demme, 1991.
The Skeleton Dance. Walt Disney, 1929.
Spider-Man: Into the Spider-Verse. Rodney Rothman, 2018.
Star Wars. George Lucas, 1977.
Strange Days. Kathryn Bigelow, 1995.
Tango. Zbigniew Rybczynski, 1981.
Tenet. Christopher Nolan, 2020.
The Terminator. James Cameron, 1984.
Triangle. Christopher Smith, 2009.
Les Vacances de monsieur Hulot. Jacques Tati, 1953.
When the Wind Blows. Jimmy T. Murakami, 1986.
You Only Live Twice. Lewis Gilbert, 1967.

Die groteske Schlussszene in Ridley Scotts sagenhaft schlechtem Hannibal
Belletristik
Zu den wenigen Vorsätzen, die ich mir jedes Jahr nehme, gehört der, mehr zu lesen. Wirklich geschafft habe ich das auch dieses Mal nicht. Zumal rund die Hälfte der Bücher, die ich gelesen habe, irgendwie mit meiner Forschung zusammenhängen. Dies gilt insbesondere für die Hannibal-Romane von Thomas Harris, die ich für einen Artikel zu Ridley Scotts Hannibal gelesen habe, der in nicht allzu ferner Zukunft erscheinen sollte. Ein Buch, das ich ohne konkreten Grund las, mit dem ich mich aber sehr abgemüht habe, war Hilary Mantels hochgelobtes Wolf Hall. Obwohl ich die Qualitäten dieses historischen Romans sehr wohl erkannte, bin ich nie wirklich hineingekommen. Zu den Highlights des Jahres gehörten Der Graf von Monte Christo und Der Stechlin, die ich beide als Hörbücher genoss. Ein neue Erfahrung für mich – ich habe vorher noch nie ganze Romane gehört.
Arthur Conan Doyle: A Study in Scarlet.
Alexandre Dumas: Der Graf von Monte Christo.
Theodor Fontane: Der Stechlin.
Jeremias Gotthelf: Die schwarze Spinne.
Dashiell Hammett: The Maltese Falcon.
Thomas Harris: Hannibal.
Thomas Harris: The Silence of the Lambs
Thomas Harris: Red Dragon.
Marlen Haushofer: Die Mansarde.
Hari Kunzru: Red Pill.
Hilary Mantel: Wolf Hall.
Arkady Martine: A Memory Called Empire.
Leo Perutz: Zwischen neun und neun.
Christopher Priest: The Magic: The Story of a Film.
Christopher Priest: The Prestige.
Adam Roberts: The This.
George Saunders: A Swim in a Pond in the Rain: In Which Four Russians Give a Master Class on Writing, Reading, and Life.
Friedrich Schiller: Wilhelm Tell.
Kurt Vonnegut Jr.: Galápagos
(Wissenschaftliche) Fachliteratur
Wie schon in den Vorjahren gilt auch heuer: Natürlich habe ich viel mehr wissenschaftliche Literatur gelesen als die folgenden Titel; einerseits führe ich hier aber weniger genau Buch, andererseits lese ich die wenigsten Monografien von vorne bis hinten durch. Dies gilt für 2022 insbesondere für Literatur zum Animationsfilm. Für die bereits erwähnte Vorlesung habe ich sehr viel gelesen, vollständig durchgearbeitet habe ich aber nur die (sehr empfehlenswerte) Übersicht von Maureen Furniss.
Unter den Büchern, die ich ohne bestimmten Grund gelesen habe – so viele sind es nicht –, stechen The Dawn of Everything und Cancel Culture Transfer heraus. Zum Buch von David Wengrow und dem viel zu früh verstorbenen David Graeber wurde schon viel geschrieben, deshalb hier nur sehr knapp: Insgesamt ist es wohl einen Tick zu lange ausgefallen, aber ich habe selten ein Buch gelesen, dass so viele vermeintliche historische Gewissheiten in Frage stellt. Adrian Daubs Cancel Culture Transfer wiederum war sehr passend in einem Jahr, in dem sich zweitweise die halbe Welt über ein abgesagtes Konzert in einem alternativen Berner Lokal zu ereifern schien. Daub argumentiert überzeugend, dass die Diskussion um angebliche Cancel Culture in den allermeisten Fällen eine Scheindiskussion ist. Das Gebrüll vermeintlich freiheitsliebender Gegner der angeblichen Cancel Culture steht eigentlich nie im Verhältnis zum tatsächlichen Anlass, der bei genauerer Betrachtung entweder nicht oder gar nicht in der kolportierten Form stattgefunden hat.
Adrian Daub: What Tech Calls Thinking: An Inquiry Into the Intellectual Bedrock of Silicon Valley.
Adrian Daub: Cancel Culture Transfer: Wie eine moralische Panik die Welt erfasst.
Fritz Breithaupt: Das narrative Gehirn Was unsere Neuronen erzählen.
Emil M. Cioran: Vom Nachteil, geboren zu sein.
Adrian J. Desmond: Darwin: The Life of a Tormented Evolutionist.
Maureen Furniss: A New History of Animation.
Valentin Groebner: Wissenschaftssprache. Eine Gebrauchsanweisung.
David Graeber: The Dawn of Everything: A New History of Humanity.
Richard Greene: Spoiler Alert!: (It’s a Book about the Philosophy of Spoilers).
Nils Daniel Peiler: To Infinity and Beyond: Die künstlerische Rezeption von Stanley Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum.. → siehe meine Rezension.
Adam Roberts: H.G. Wells: A Literary Life.