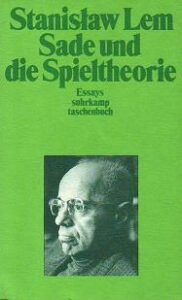
Ein langer Weg: Von hier
Dem polnischen Schriftsteller Stanisław Lem kommt in meinem wissenschaftlichen Werdegang, aber auch in meiner Science-Fiction-Biografie (wenn es denn so etwas gibt) eine wichtige Rolle zu. Ich stiess Ende meiner Teenager-Jahre auf Lems Werk – ein Schuber von Suhrkamp mit fünf Lem-Büchern, den ich damals erstand, steht nach wie vor in meinem Regal – und war davon ziemlich begeistert. In meinem Enthusiasmus übernahm ich weitgehend die zu dieser Zeit im deutschsprachigen Raum vorherrschende Einschätzung, dass Lem innerhalb der Science Fiction, die ich nur sehr bruchstückhaft kannte, die grosse Ausnahme darstellte: Ein Autor, der seine trivialen Kollegen sowohl hinsichtlich seiner wissenschaftlichen wie auch seiner literarischen Bildung haushoch überragte, der im Grunde als einziger Science Fiction schrieb, die diesen Namen tatsächlich verdiente.

Über da
Ein paar Jahre später, 2001 um genau zu sein, ich studierte an der Humboldt Universität zu Berlin, begegnete mir dann in einem Seminar zum phantastischen Film erstmals Tzvetan Todorovs Einführung in die fantastische Literatur, ein Text, der bei mir vor allem für Irritation sorgte. Denn was Todorov darin beschreibt, hatte offensichtlich nichts mit Science Fiction zu tun und schien mir auch sonst eher wirr. Ich weiss nicht, ob es mehr über mich oder über den Kurs aussagt, dass mir damals nicht klar war, dass die Veranstaltung ja gar nicht Science Fiction, sondern eben den phantastischen Film zum Thema hatte. Wie dem auch sei: Todorov passte mir nicht, und so empfand ich es denn als regelrechten Wink des Schicksals, als ich auf einem der vielen Büchertische, die ich leidenschaftlich durchstöberte, einen Band des von mir so geschätzten Lems fand, der einen Text mit dem Titel «Tzvetan Todorovs Theorie des Phantastischen» enthielt. Genau das hatte mir gefehlt; endlich würde jemand, der wirklich wusste, was Sache ist, Todorov mal zeigen, wo der Hammer hängt. In der Folge nahm ich mir zuerst Lems Essay vor und machte mich, einmal auf den Geschmack gekommen, danach auch an dessen theoretisches Opus magnum, das zweibändige Phantastik und Futurologie.
Die Auseinandersetzung mit Todorov respektive Lem war kurzfristig sehr unproduktiv, dafür langfristig umso folgenreicher. Im Laufe der Lektüre wurde mir nämlich klar, dass Lem als Literaturtheoretiker schlicht unbrauchbar und Phantastik und Futurologie ein Unding ist (merke: Wenn ein Schriftsteller ein grosses, am besten über 500-seitiges theoretisches Werk schreibt, missglückt es in aller Regel). Irgendwann brach ich meinen Versuch, Todorov mittels Lem Herr zu werden, ab und wandte mich anderen Autoren zu, die mir helfen sollten, die Phantastik bzw. die Science Fiction besser zu verstehen. Diese Suche mündete schliesslich in meine Dissertation Die Konstitution des Wunderbaren. Am Anfang meiner Beschäftigung mit Science Fiction, die noch heute meine wissenschaftliche Arbeit prägt, stand somit Lem (ein weiterer Ableger ist der Band Theoretisch phantastisch, der sich ganz Todorov widmet).

Hierhin
Obwohl meine Begeisterung für Lem damals Schaden nahm – mittlerweile erkannte ich zudem, dass es durchaus auch andere fähige AutorInnen in der SF gab –, trug ich seit Jahren die Idee mit mir herum, mal etwas zu Phantastik und Futurologie zu schreiben, einem Werk, zu dem so gut wie nichts publiziert wurde und das in der theoretischen Diskussion praktisch inexistent ist. Als mein geschätzter Phantastik-Kollege Jacek Rzeszotnik mich vergangenes Jahr anfragte, ob ich etwas zu einem Band anlässlich von Lems hundertsten Geburtstag beisteuern würde, müsste ich deshalb nicht lange überlegen.
Und nun ist der schöne Band Ein Jahrhundert Lem. 1921–2021 also da. Darin enthalten mein Artikel «Aus Lems Steinbruch der Theorie. Zu Phantastik und Futurologie», die meines Wissens umfassendste kritische Würdigung von Lems Versuch einer Theorie der Science Fiction.
EDIT: Der Artikel ist steht nun zum Download bereit.
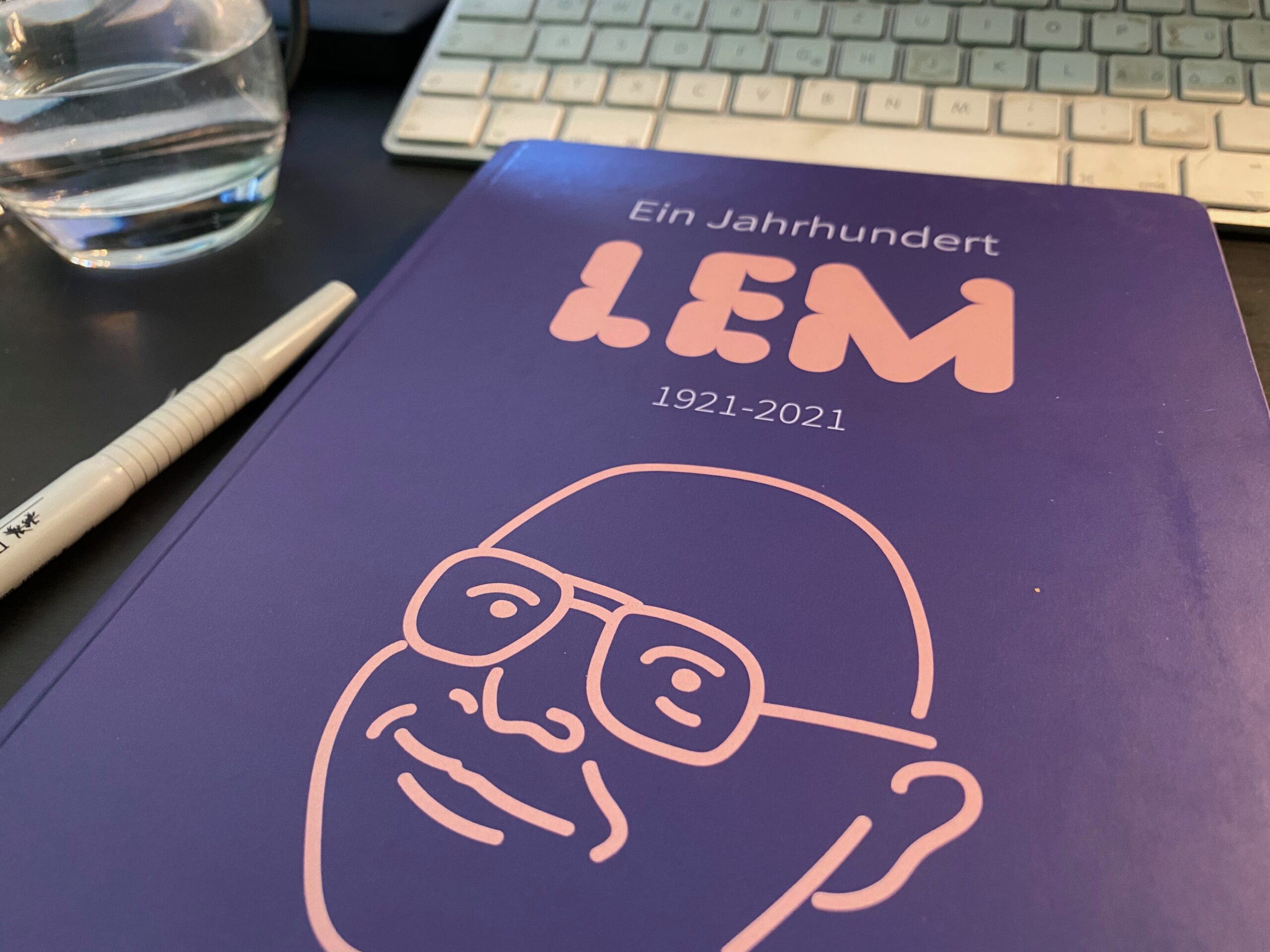
Und schliesslich hierhin
Erwähnte Werke
Lem, Stanisław: Phantastik und Futurologie. Bd. 1. Aus dem Polnischen übers. von Beate Sorger und Wiktor Szacki. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1977.
Lem, Stanisław: Phantastik und Futurologie. Bd. 2. Aus dem Polnischen übers. von Edda Werfel. Frankfurt a. M.: Insel Verlag 1984.
Todorov, Tzvetan: Einführung in die fantastische Literatur. Aus dem Französischen übers. von Karin Kersten, Senta Metz und Caroline Neubaur. Frankfurt a.\,M.: Fischer 1992.
Lem, Stanisław: «Tzvetan Todorovs Theorie des Phantastischen». In: Ders.: Essays. Bd. 1. Sade und die Spieltheorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1981, 9–34.
Spiegel, Simon: Die Konstitution des Wunderbaren. Zu einer Poetik des Science-Fiction-Films. Marburg: Schüren 2007. →
Spiegel, Simon: Die Theoretisch phantastisch. Eine Einführung in Tzvetan Todorovs Theorie der phantastischen Literatur. Murnau am Staffelsee: p.machinery 2010. →
Spiegel, Simon: «Aus Lems Steinbruch der Theorie. Zu Phantastik und Futurologie». In: Rzeszotnik, Jacek (Hg.): Ein Jahrhundert Lem (1921–2021). Wrocław/Dresden: ATUT/Neisse Verlag 2021, 67–81.
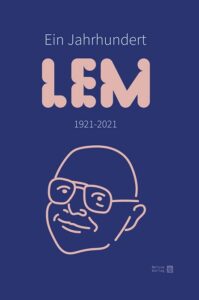 Mein Artikel «Aus Lems Steinbruch der Theorie» zu Stanisławs Lem theoretischem Opus magnum Phantastik und Futurologie, von dem früher bereits die Rede war, ist nun als PDF frei verfügbar.
Mein Artikel «Aus Lems Steinbruch der Theorie» zu Stanisławs Lem theoretischem Opus magnum Phantastik und Futurologie, von dem früher bereits die Rede war, ist nun als PDF frei verfügbar.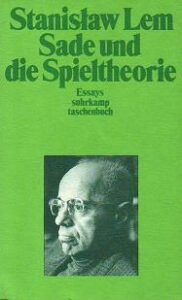


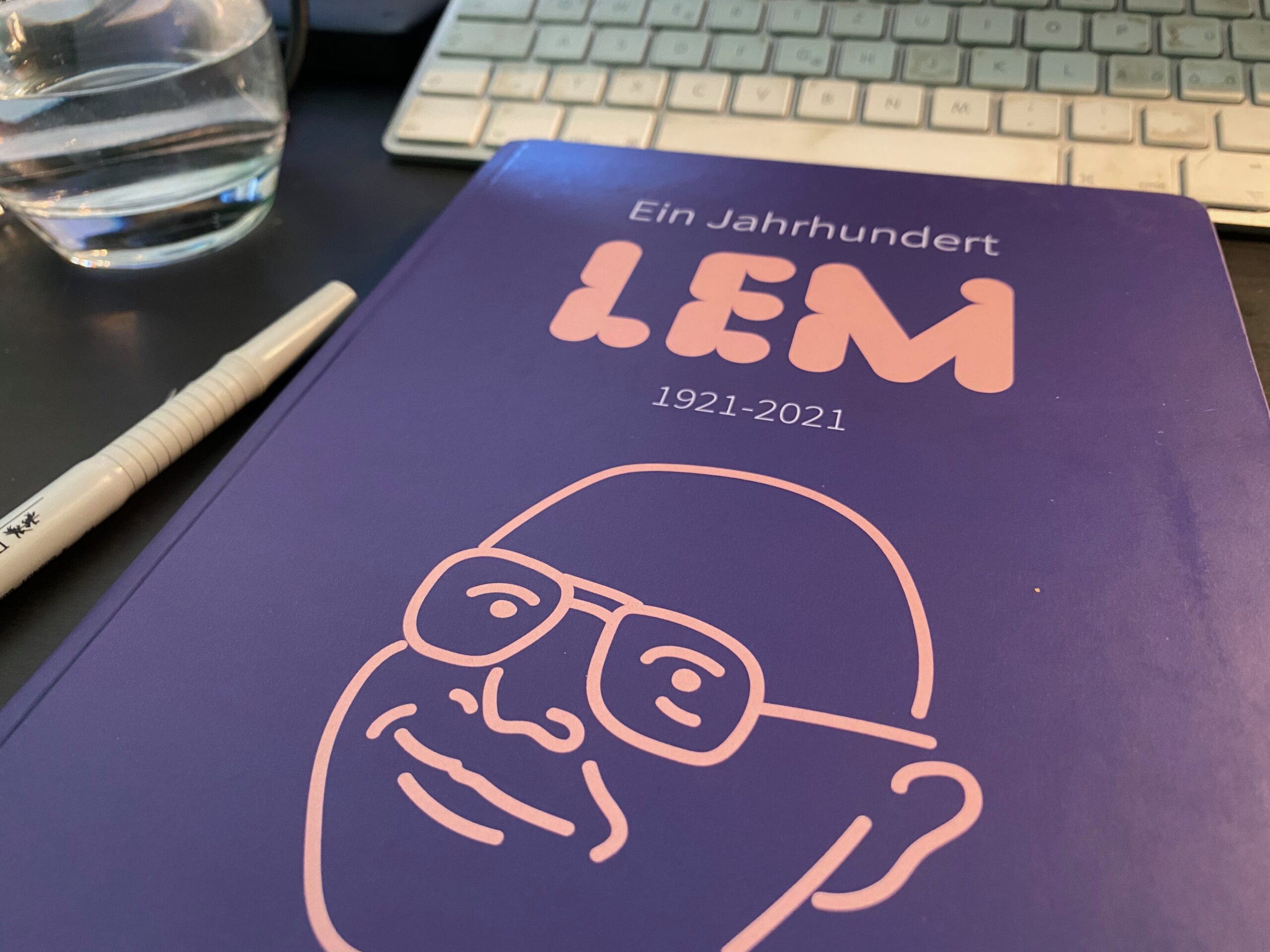


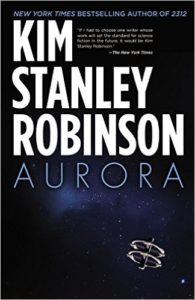



![[zff]_99814-9_1-2015.indd](http://www.utopia2016.ch/wp-content/uploads/2015/06/g99814-9-208x300.jpg) Während der Phantastik-Artikel eher eine Frucht meiner bisherigen wissenschaftlichen Beschäftigung darstellt, ist der zweite Artikel, Thomas Schölderles «Die Genese Utopias», direkt mit meinem aktuellen Forschungsprojekt verbunden. Schölderles Dissertation
Während der Phantastik-Artikel eher eine Frucht meiner bisherigen wissenschaftlichen Beschäftigung darstellt, ist der zweite Artikel, Thomas Schölderles «Die Genese Utopias», direkt mit meinem aktuellen Forschungsprojekt verbunden. Schölderles Dissertation 


