Wie immer gilt ein genereller Spoilervorbehalt.[ref]Grundsätzlich kann hier jede Pointe, jeder Twist, jede Überraschung verraten werden. Wer an Spoilerphobie leidet, sollte die Einträge zu aktuellen Filmen somit besser meiden.[/ref]
Angesichts des gigantischen kommerziellen Erfolgs von Avatar: The Way of Water kann man wohl guten Gewissens davon ausgehen, dass alle, die sich auch nur entfernt für den Film interessieren, ihn mittlerweile mindestens einmal gesehen haben. Eine traditionelle Kritik, die den Film vorstellt und ihn bewertet, erübrigt sich somit weitgehend. Entsprechend ist mein Ziel hier denn auch nicht eine klassische Rezension, sondern eher der Versuch einer allgemeineren Einordnung.
Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist ein Artikel aus meiner Feder, der vor 13 Jahren an dieser Stelle, sprich: im Science Fiction Jahr 2010, erschienen ist und James Camerons erstem Avatar-Film gewidmet war. Zu Beginn dieses Textes ist folgender Satz zu lesen:
Avatar dürfte für die kommenden Jahre den Referenzwert für SF-Blockbuster darstellen, und da scheint es mir angebracht, diesen Film ein bisschen theoretisch abzuklopfen und mit einigen gängigen Konzepten der SF-Forschung zu konfrontieren.
Was immer man auch von meinem darauffolgenden Abklopfen halten mag, mit der Einschätzung, dass Camerons Film zur Messlatte für die nachfolgende SF-Produktion werden sollte, lag ich gehörig daneben. Denn fast noch erstaunlicher als der Erfolg des Films ist die Tatsache, dass er so gut wie keine Spuren hinterlassen hat. Das war damals nicht ohne Weiteres absehbar; vielmehr schien es für einen Moment, als fände Avatar bei ganz unterschiedlichen Gruppen Anklang und würde nicht nur zu einem kommerziellen, sondern auch zu einem kulturellen Phänomen. So war unmittelbar nach Erscheinen des Films unter anderem zu lesen, dass er in China wegen seines potenziell umstürzlerischen Potenzials von Dissidenten geschaut und der Obrigkeit kritisch beäugt würde. Auch verschiedene Umweltaktivisten beriefen sich eine Zeit lang auf den Film. Diese und ähnliche Erscheinungen waren aber nur von kurzer Dauer; mittelfristig folgte darauf – nichts.
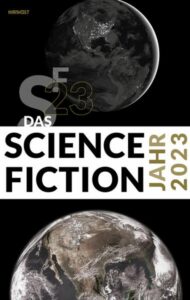 Zur Erinnerung: Mit einem Gesamteinspielergebnis von fast drei Milliarden US-Dollar gilt Avatar nach wie vor als kommerziell erfolgreichster Film aller Zeiten. Diese schwindelerregenden Zahlen stehen in krassem Gegensatz zu seiner popkulturellen Bedeutung. Wenn man sich die heutige Medienlandschaft und auch das weitere SF-Umfeld anschaut, scheint es fast so, als habe Camerons Film nie stattgefunden. Seien es Zitate in anderen Filmen, Internet-Memes, Fan Fiction oder Cosplayer im Na’vi-Look – das alles gab und gibt es nicht, oder wenn, dann nur in sehr bescheidenem Umfang.
Zur Erinnerung: Mit einem Gesamteinspielergebnis von fast drei Milliarden US-Dollar gilt Avatar nach wie vor als kommerziell erfolgreichster Film aller Zeiten. Diese schwindelerregenden Zahlen stehen in krassem Gegensatz zu seiner popkulturellen Bedeutung. Wenn man sich die heutige Medienlandschaft und auch das weitere SF-Umfeld anschaut, scheint es fast so, als habe Camerons Film nie stattgefunden. Seien es Zitate in anderen Filmen, Internet-Memes, Fan Fiction oder Cosplayer im Na’vi-Look – das alles gab und gibt es nicht, oder wenn, dann nur in sehr bescheidenem Umfang.
Die nachhaltigste Wirkung, das sei hier nur in aller Kürze erwähnt, hat Avatar hinter den Kulissen entfaltet. Ohne den durch den Film initiierten, inzwischen längst abgeflauten 3-D-Boom hätte die Kinobranche nie so rasch von analoger auf digitale Projektion gewechselt, wie es zu Beginn der 2010er-Jahre geschah.
Dass ein so erfolgreicher Film derart in Vergessenheit gerät, hängt wohl unter anderem damit zusammen, dass Avatar trotz aller technischen Höchstleistungen im Grunde ein altmodischer Film war. Oder zumindest ein Film, der entgegen meiner ursprünglichen Einschätzung in mehrfacher Hinsicht keine neue Epoche einläutete, sondern eine vergangene abschloss. Avatar hat sehr viel mehr mit dem Actionkino der 1980er- und 1990er-Jahre gemein, einer Ära, die Cameron maßgeblich mitgeprägt hat, als mit dem Muster, das sich in den vergangenen zwanzig Jahren in Hollywood durchgesetzt hat.
Der magische Begriff, der heute das Denken der US-Filmindustrie bestimmt, lautet Franchise. Für die Hollywood-Majors sind einzelne Filme, insbesondere wenn sie auf Original-Drehbüchern basieren, uninteressant geworden. In einen nicht erprobten Stoff 150 oder 200 Millionen Dollar zu investieren, ist schlicht zu riskant. Die diversen Comic- und Games-Verfilmungen, Sequels, Prequels und Reboots, die seit der Jahrtausendwende die Leinwände dominieren, sind alle Ausdruck dieser Logik. Und da die Studios längst Teil großer Medienkonglomerate sind, werden die Stoffe – oder, wie man im Branchen-Jargon sagt, das IP – immer auch crossmedial ausgewertet; in Games, Comics, Romanen, Serien etc.
In dieser medialen Landschaft erscheint Avatar als alleinstehender, nicht als Franchise konzipierter Film, der nicht an ein bestehendes erzählerisches Universum anknüpft, rückblickend schon fast wie ein Anachronismus. Camerons Drehbuch klaut zwar fleißig bei existierenden Stoffen, und natürlich gab es auch ein Avatar-Game und Avatar-Action-Figuren, im Grunde folgte der Film aber einem überholten Modell.
Dass sein Film ein wenig aus der Zeit gefallen war, wurde irgendwann wohl auch Cameron klar, denn mit Avatar: The Way of Water beschreitet er den umgekehrten Weg und übernimmt schon fast mechanisch all jene Elemente, mit denen Marvel und Konsorten in den vergangenen zwei Jahrzehnten erfolgreich waren. Dass der Film die erste von insgesamt vier geplanten Fortsetzungen darstellt, ist dabei nur eine, wenn auch wohl die offensichtliche Folge dieser Strategie. Darüber hinaus folgt der Film aber auch inhaltlich fast schon sklavisch dem Gerüst, das insbesondere dem modernen Superheldenfilm zugrunde liegt. Ich werde im Folgenden die wichtigsten Punkte diskutieren, bei denen sich Cameron kräftig Inspiration bei der Konkurrenz holte.
Familie als zentraler Wert. Heldentum, das war in Hollywood – und auch jenseits davon – lange gleichbedeutend mit dem Kampf für etwas Größeres. Sei es das Vaterland, Gerechtigkeit oder Freiheit, der traditionelle Held – und die männliche Form ist hier nur sehr bedingt generisch zu verstehen – handelte im höheren Auftrag. Zwar gab es immer mal wieder eine Angetraute oder ein anderes Familienmitglied zu retten, doch die diversen Damsels in Distress waren eher Schikanen und Stolpersteine auf dem mühsamen Weg der Hauptfigur und nicht der eigentliche Grund, weshalb diese auszog. Dies hat sich um die Jahrtausendwende grundlegend geändert. Seien es Peter Parker und unzählige andere Superhelden, Dominic Toretto in der Fast-and-Furious-Reihe oder die Skywalker-Sippe in Star Wars – der Schutz der Familie ist zum zentralen erzählerischen Motor geworden. Selbst James Bond, der Inbegriff des heldenhaften Einzelgängers, wurde in No Time to Die eine Tochter verpasst. Der Kampf des Helden gilt nicht mehr einem höheren Wert, sondern dem unmittelbaren Umfeld, was in der Serie The Last of Us darin gipfelt, dass der Protagonist das Überleben seiner – gewählten – Tochter über den Erhalt der Menschheit stellt.
The Way of Water übernimmt dieses Muster mit Nachdruck. In Avatar führte Jake Sully noch einen Aufstand gegen die böse Besatzungsmacht an, seine Loyalität galt den Na’vi als Ganzes. Davon ist in der Fortsetzung nichts mehr zu spüren. Als Neytiri darauf besteht, dass sie ihr Volk nicht verlassen will, reicht ein Satz Jakes, um sie zum Schweigen zu bringen: »This is about our family.«
Um ganz sicherzugehen, doppelt das Drehbuch noch nach und verpasst Jakes Gegenspieler Quaritch mit der Figur von Spider ebenfalls einen Sohn. Dass Spider seinen Vater nur als Bösewicht aus Erzählungen kennt und die blaue Gestalt, die ihm gegenübertritt, mit seinem biologischen Erzeuger nichts zu tun hat, ist Nebensache. Wahre Vater-Sohn-Liebe transzendiert in der Logik Hollywoods solche Kleinigkeiten.
Trauma. Eng mit der Fokussierung auf die Familie verbunden ist ein anderer Trend: War der klassische Held eine ungebrochene Figur, gehört heute ein handfestes Trauma – meist der Tod eines Nahestehenden – fast schon zur heldischen Grundausstattung. Auch in dieser Hinsicht hat das Superhelden-Genre das Modell geliefert. Der Tod eines Familienangehörigen war zwar schon immer wichtiger Teil der Origin Story von Superman, Batman und Co., dieses Ereignis hatte aber zumindest im Film lange keine traumatischen Qualitäten, beeinflusste die Gestaltung der Figur bestenfalls peripher. Spätestens mit Christopher Nolans Batman-Trilogie, die diesbezüglich stark von den Graphic Novels der 1980er-Jahre beeinflusst ist, haben wir es heute aber fast ausschließlich mit gebrochenen Helden zu tun, die mit sich und ihrem Platz in der Welt hadern. Auch hier sei noch einmal auf James Bond verwiesen, einer Figur, die sich lange just durch die Abwesenheit eines nennenswerten Innenlebens auszeichnete, in der Daniel-Craig-Ära aber von Film zu Film mit mehr seelischen Schrammen versehen wurde.
Der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Avatar-Film ist, wenn es um Traumata geht, besonders frappant. Eigentlich bringt Jake zu Beginn des ersten Teils alle Voraussetzungen für einen zünftigen seelischen Knacks mit, schließlich ist er ein Paraplegiker, der gerade seinen Zwillingsbruder verloren hat. Ersteres motiviert ihn zwar dazu, am Avatar-Experiment teilzunehmen, belastet ihn aber ansonsten nicht sonderlich. Der Tod seines Bruders scheint ihn noch weniger zu berühren und hat denn auch keinerlei Relevanz für die Handlung. Als ginge es darum, diese verpasste Chance einer backstory wound wettzumachen, türmt Cameron in The Way of Water die Traumata regelrecht aufeinander. Neben Spider, von dessen schwierigem Verhältnis zu seinem Vater bereits die Rede war, ist in diesem Zusammenhang vor allem Kiri zu nennen, die in so etwas wie dem Pandora-Äquivalent einer jungfräulichen Geburt gezeugt wurde. Ein Umstand, der ihr schwer zu schaffen macht. Und als wäre das noch nicht genug, wird uns mit Payakan schließlich noch ein traumatisierter Walfisch – Pardon, ein Tulkun – präsentiert.
Komplexes Erzählen. Die Art und Weise, wie populäre Filme und Serien ihre Geschichten erzählen, hat sich in den vergangenen 25 Jahren grundlegend gewandelt. Die klassische Hollywood-Dramaturgie zeichnet sich durch effiziente Schlichtheit aus: Der Held verfolgt ein Ziel und muss, um dieses zu erreichen, zahlreiche Hindernisse überwinden – meist mit siegreichem Ausgang. Ende der 1990er-Jahre kommen dann allmählich komplexe Erzählformen in Mode; damit bezeichnet die Filmwissenschaft insbesondere bei Serien verästelte Plots mit unerwarteten Wendungen und einer Vielzahl von Figuren. Also Geschichten, bei denen sich am Ende herausstellt, dass alles ganz anders war, als es zu Beginn den Anschein hatte.
Diese Form des Erzählens ergänzt den Franchising-Trend in idealer Weise. Je mehr Figuren es gibt und je verwickelter sich die Handlung präsentiert, umso mehr Prequels, Sequels und Tie-ins sind möglich. Einmal mehr stellen die Marvel-Filme das Vorbild dar, dem alle nacheifern.
Ist der Plot von Avatar an Schlichtheit kaum zu überbieten, bemüht sich The Way of Water sichtlich um Komplexität. Wobei: Im Grunde ist das, was Cameron hier inszeniert, lediglich Pseudokomplexität. Damit meine ich, dass der Film zwar eine Vielzahl von Figuren einführt, darunter mehrere mit besonderen Fähigkeiten und/oder einer rätselhaften Vorgeschichte, erzählerisch führt das aber zu erstaunlich wenig. Ja, Kiri hat offensichtlich besondere Fähigkeiten und Spider ein Problem mit seiner Herkunft. Beides ist für den Plot, der unweigerlich auf einen Showdown zwischen Jake und Quaritch hinausläuft, aber unerheblich. Man könnte den Film problemlos um eine Dreiviertelstunde kürzen, ohne dass etwas Wesentliches fehlen würde, denn ein Großteil dessen, was der Film entfaltet, ist Beiwerk ohne erzählerischen Eigenwert. Dass Cameron dennoch diesen Aufwand betreibt, dürfte einen simplen Grund haben: Die diversen Plot-Ornamente werden dereinst als Ansatzpunkte für die weiteren Fortsetzungen dienen, sind mit anderen Worten nur Andockstellen im angestrebten Franchise-Gebilde.
Auferstehung. Vielleicht ist es ein Zustand, den jedes Franchise früher oder später erreichen muss, vielleicht ist es auch nur ein Zufall, aber die beiden derzeit erfolgreichsten Franchises – das Marvel Cinematic Universe (MCU) und Star Wars – sind beide an einem Punkt angelangt, an dem bei Bedarf alles rückgängig gemacht werden kann. Dank erzählerischer Gimmicks wie der Force, Zeitreisen oder dem Multiversum kann Rey, kaum hat sie Kylo Ren besiegt, diesen wieder zum Leben erwecken, sind weder Luke noch Leia je wirklich tot und kann in Avengers: Endgame selbst Thanos’ Dezimierung des Universums aufgehoben werden. Dass die langfristigen Konsequenzen dieser erzählerischen Haltung fatal sind, dass eine Geschichte, bei der nichts mehr auf dem Spiel steht, weil alles, was geschieht, auch anders sein könnte, schlicht uninteressant wird, sei hier nur am Rande erwähnt. Auffällig ist auf jeden Fall, dass dieses Phänomen beim MCU und Star Wars erst nach einer langen Reihe von Filmen auftritt und insgesamt eher wie eine Abnutzungserscheinung wirkt, sich im Falle von Avatar dagegen bereits im zweiten Film bemerkbar macht. So wird Quaritch gleich zu Beginn in einem sehr unbeholfenen Akt von rückwirkender Kontinuität – oder neudeutsch Retconning – wiederbelebt. Warum dies nötig ist, warum man Jake nicht einfach einen anderen Widersacher verpasst hat, wird nie recht klar. Noch folgenreicher dürfte aber die Szene sein, in der Kiri in einer durch den Baum der Geister herbeigeführten religiösen Vision auf ihre Mutter trifft. Der Baum der Geister, respektive Eywa, die mystische Kraft, die alles auf Pandora durchfließt, hat hier eine ganz ähnliche Funktion wie die Force in Star Wars, und mir scheint die Prognose nicht sonderlich verwegen, dass dank ihr in späteren Filmen verstorbene Figuren nach Bedarf wieder zum Leben erweckt werden können.
Falls es noch nicht klar geworden sein sollte – Avatar: The Way of Water ist in meinen Augen ein ziemlich schlechter Film. Schuld daran sind in erster Linie die fünf angeführten Punkte. Würde man das über dreistündige Ungetüm radikal zusammenschneiden, erhielte man wahrscheinlich einen recht ansehnlichen Actionkracher. In seinem krampfhaften Bemühen, die Rezepte der Konkurrenz zu imitieren, hat Cameron aber einen Film geschaffen, der trotz allem technischen und erzählerischen Aufwand über weite Strecken leblos und nicht selten langweilig wirkt. Die phänomenalen Zuschauerzahlen legen aber nahe, dass ich mit dieser Meinung in der Minderheit bin, und so ist zu befürchten, dass die Fortsetzungen im gleichen Stil weiterfahren werden. Wobei: Da ich schon beim ersten Avatar mit meiner Prognose falschlag, besteht noch immer Hoffnung. Vielleicht irre ich mich ja erneut und Avatar 3 wird ein richtig guter Film.
Erschienen im Science Fiction Jahr 2023



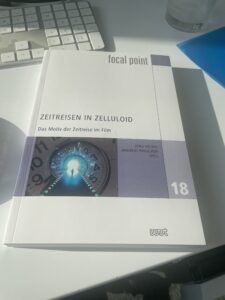
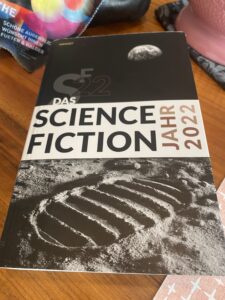


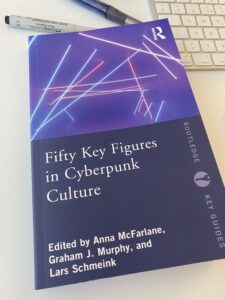
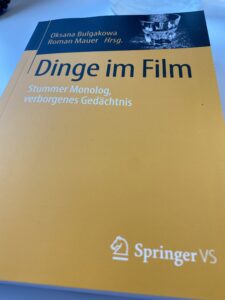

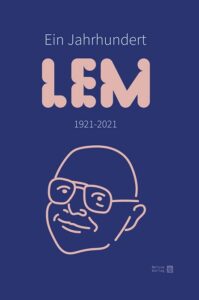
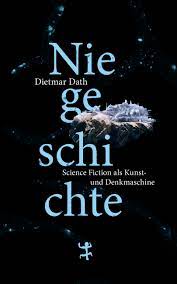

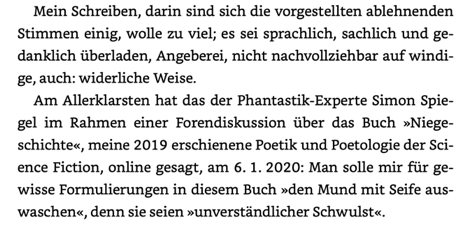 Zu meiner Rezension
Zu meiner Rezension