Herzlichen Dank an Pathé Films und die Solothurner Filmtage.
Herzlichen Dank an Pathé Films und die Solothurner Filmtage.
Zum Abschluss meiner diesjährigen Konferenzentournee war ich diese Woche an der internationalen Tagung 100 Years of Ostranenie an der Universität Erfurt.
Mit Ostranenie bezeichnet der Russische Formalist Victor Šklovskij in seinem Aufsatz «Die Kunst als Verfahren» einen Typus stilistischer Verfahren, bei dem vermeintlich bekannte Gegenstände durch ungewohnte Darstellungsverfahren verfremdet werden. Für Šklovskij zeichnet sich Kunst – und damit auch Literatur – dadurch aus, dass sie uns die Dinge wieder neu sehen lässt. Während unsere Alltagswahrnehmung oft automatisiert ist – das heisst, wir nehmen viele Dinge gar nicht mehr als das wahr, was sie wirklich sind –, ist es die Aufgabe von Kunst, uns die Dinge wieder sehen zu lassen; Šklovskij formuliert es in einer viel zitieren Passage folgendermassen:
Und gerade, um das Empfinden des Lebens wiederherzustellen, um die Dinge zu fühlen, um den Stein steinern zu machen, existiert das, was man Kunst nennt. Ziel der Kunst ist es, ein Empfinden des Gegenstandes zu vermitteln, als Sehen, und nicht als Wiedererkennen (Šklovskij 1969: 15).
Mittels ostranenie verhindern literarische Texte eine automatisierte Wahrnehmung; das Verfahren wirkt quasi als kognitiver Bremsblock, der den Rezipienten dazu zwingt, vermeintlich Bekanntes nicht bloss wieder zu erkennen, sondern in seiner tatsächlichen Qualitität zu sehen.
Ich habe mich in meiner Dissertation ausführlich mit Šklovskijs Ostranenie-Konzept auseinandergesetzt. Vor allem deshalb, weil sich Darko Suvin, der Urvater der SF-Forschung, in seiner Poetik der Science Fiction auf ihn bezieht. Suvin versteht SF als «erkenntnisbezogene Verfremdung» («cognitive estrangement»). Wie ich in meinem Buch darlege, meint er damit aber etwas ganz anderes als Šklovskij. Tatsächlich vollführt SF auf formaler Ebene das genaue Gegenteil von Ostranenie –die fremden Elemente werden nicht verfremdet, sondern erscheinen vielmehr als normal, sie werden naturalisiert.1
Obwohl Ostranenie für mich somit ein wichtiges Konzept ist, hätte ich wohl kein Paper für die Konferenz eingereicht, wenn nicht deren rührige Organisatorin, die stets enthusiastische Alexandra Berlina, die dieser Tage auch einen Šklovskij-Readerveröffentlicht hat, auf mich zugekommen wäre. Als Nicht-Slawist war ich an der Konferenz klar in der Minderheit. Soweit ich das einschätzen kann, kam mein Vortrag, in dem ich mein Konzept anhand von Edward Bellamys utopischem Roman Looking Backward entwickelte, aber dennoch ganz gut an. Selbst ein akuter Verfremdungsmoments meinerseits, während dem ich nicht mehr zwischen «familiar» und «strange» unterscheiden konnte (s. Video, Vortrag auf Englisch), schien nicht allzu negativ gewirkt zu haben.
Bellamy, Edward: Looking Backward: 2000–1887. New York 2009 (11888).
Šklovskij, Viktor: «Die Kunst als Verfahren».Aus dem Russischen übers. von Rolf Fieguth. In: Striedter, Jurij (Hg.): Texte der Russsischen Formalisten. Bd. 1. Texte zur allgemeinen Literaturtheorie und zur Theorie der Prosa. München 1969, S. 3–35.
Spiegel, Simon: Die Konstitution des Wunderbaren. Zu einer Poetik des Science-Fiction-Films. Marburg 2007.
Suvin, Darko: Poetik der Science Fiction. Zur Theorie einer literarischen Gattung. Aus dem Englischen übers. von Franz Rottensteiner. Frankfurt a. M. 1979 (Original: Metamorphoses of Science Fiction. Yale 1979).
Wer mir auf Twitter oder Facebook folgt, weiss es schon, den zweieinhalb Nasen, die das nicht tun und dennoch meinen Blog lesen, sei es hiermit stolz kundgetan: Wie gestern an der Pressekonferenz der Solothurner Filmtage bekannt gegeben wurde, habe ich den «Prix Pathé – Preis der Filmpublizistik» 2017 in der Kategorie «Grand prix» gewonnen. Ausgezeichnet wurde meine im Filmbulletin erschienene Spoiler-Kolumne «Die Dramaturgie des Realen» zu Marcel Gislers Electroboy.
Der Preis freut mich natürlich sehr; nicht zuletzt, weil damit auch das Filmbulletin und dessen Chefredakteurin Tereza Fischer geehrt wird. Der Prix Pathé wird seit 2006 vergeben, just die Zeitschrift, die in der Schweiz synonym für gehobene Filmpublizistik steht, war bislang aber aus nicht recht nachvollziehbaren Gründen vom Preis ausgeschlossen. Für die aktuelle Ausgabe wurde das Reglement nun angepasst – mit Erfolg!
Die offizielle Verleihung findet am 25. Januar 2017 im Rahmen der Solothurner Filmtage statt.
Vor 500 Jahren erschien mit Thomas Morus’ Utopia die erste literarische Utopie. Seither haben Utopisten auf der ganzen Welt unzählige Entwürfe alternativer Gesellschaftsordnungen vorgelegt. Wie aber sieht es damit im Film aus?
Ursprünglich erschienen im Filmbulletin 8/2016.
Dass die Realität ein sehr unangenehmer Ort sein kann, wissen wir nicht erst, seit das US-Stimmvolk Donald Trump zum Präsidenten gewählt hat. Die Sehnsucht nach anderen – besseren – Verhältnissen ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Lange schlugen sich derartige Wünsche vor allem in Mythen und religiösen Erzählungen nieder. Der bessere Ort war nicht von dieser Welt, sondern in göttlichen Sphären angesiedelt.
Der spätere Lordkanzler und Märtyrer Thomas Morus war also keineswegs der Erste, als er vor genau 500 Jahren in Utopia ein ideales Gemeinwesen entwarf. Sein Buch unterscheidet sich von Mythen und Schlaraffen landerzählungen aber dadurch, dass seine bessere Welt eine diesseitige, von Menschen geschaffene ist. Die bessere Welt, so Morus’ revolutionärer Ansatz, kann bereits im Hier und Jetzt Realität werden. Zwar ist sich die Morus-Forschung einig, dass Utopia keineswegs das Ideal ihres Autors darstellt – ou-topos bedeutet nicht umsonst Nichtort –, sondern auch satirisch gedacht ist. An der subversiven Qualität des Textes ändert das wenig. Denn was dieser deutlich macht, ist, dass die Welt keineswegs so sein muss, wie sie ist. Alternativen sind denkbar. Dass diese Haltung gerade in einer Zeit Zündstoff birgt, in der die Politik regelmässig von alternativlosen Szenarien spricht, ist offensichtlich. Die Utopie erlebt denn auch vielerorts eine Art Revival.
In seinem Buch lässt Morus den weitgereisten Raphael Hythlodaeus von der Insel Utopia berichten, deren Bewohner eine Art geldlosen Kommunismus praktizieren. Ihr oberstes Gebot ist die Vernunft, und alles ist darauf ausgerichtet, dass sich jeder in die gesellschaftliche Maschinerie einfügt und seinen Teil beiträgt. Arbeit wird gleichmässig und gemäss der jeweiligen Fähigkeiten aufgeteilt, jeder kriegt, was er wirklich zum Leben braucht, vom Staat; Prunksucht, Neid und Gier und alle damit verbundenen Verbrechen sind deshalb unbekannt. So kommen die Utopier mit einem Minimum an Gesetzen aus.
Mit Utopia hat Morus den Urtext für ein ganzes Genre geschaffen. Seither sind unzählige weitere utopische Texte entstanden, etwa Francis Bacons posthum ver öffentlichte Wissenschaftsutopie Neu-Atlantis (1627), Eduard Bellamys Looking Backward (1888) oder Walden Two (1948), die behavioristische Utopie des Psychologen B. F. Skinner. Diesen mehr oder weniger bekannten Texten steht eine Unzahl von weitgehend vergessenen Entwürfen gegenüber. Viele wurden schon bei Erscheinen kaum wahrgenommen, andere fanden hingegen begeisterte Anhänger. Insbesondere im 19. Jahrhundert machten sich die unterschiedlichsten Gruppierungen daran, ihre utopischen Visionen in die Realität zu überführen – in aller Regel erfolglos.
Angesichts dieses steten, bis heute nicht ab brechenden Stroms literarischer Utopien drängt sich die Frage auf, wie es damit beim Film bestellt ist. Eine erste Rundschau fördert wenig zutage; zwar gibt es einige über die Filmgeschichte verstreute Exoten wie die H.-G.-Wells-Verfilmung Things to Come (1936) oder den feministischen Underground-Film Born in Flames (1983), die verhältnismässig viel Zeit auf die Darstellung einer alternativen Gesellschaft verwenden.1 Auch Werke wie Alain Tanners Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000 (1976) oder der unlängst gestartete Captain Fantastic (2016), die danach fragen, ob Lebensformen jenseits des Kapitalismus möglich sind, fügen sich in einen utopischen Diskurs ein. Letztlich handelt es sich hierbei aber um Einzelfälle, von denen zudem keiner seinen Gesellschaftsentwurf auch nur annähernd so ausführlich beschreibt wie eine typische Utopie.
Denn in dem von Morus etablierten Modell steht die Beschreibung des Staats im Vordergrund; wie sind die Staatsgeschäfte, die Verteilung von Gütern und Arbeit, Familienleben, Erziehung, Justiz und Kriegswesen organisiert? Die Utopie will den Leser von ihrer Tauglichkeit überzeugen, und dies tut sie durch Vollständigkeit, durch eine möglichst lückenlose Beschreibung des jeweiligen Staatswesens. Der Plot, sofern überhaupt vorhanden, ist reine Staffage und dient bloss als Vorwand, um den Gesellschaftsentwurf ausführlich darzulegen. Eine nennenswerte Handlung gibt es nicht, die Figuren bleiben in der Regel platt und fungieren als Sprachrohr des Autors.
Für einen Spielfilm sind das denkbar schlechte Voraussetzungen, und so erstaunt es nicht, dass es die Klassiker der utopischen Literatur allesamt nicht auf die Leinwand geschafft haben. Ganz anders sieht es dagegen bei der Dystopie aus, die im Gegensatz zur Utopie die schlimmste aller möglichen Welten beschreibt. Meist sind das totalitäre Staaten, deren Bewohner zu gesichts- und emotionslosen Masken degradiert werden. In dieser unmenschlichen Gesellschaft gibt es aber stets einen oder mehrere Rebellen, die die Schlechtigkeit des Systems erkennen und dagegen rebellieren. Die Dystopie hat somit von Haus aus einen spannenden Plot, was erklärt, warum dieses Genre seit George Lucas’ Erstling THX 1138 (1971) und den Adaptationen dystopischer Klassiker so beliebt ist, etwa George Orwells Nineteen Eighty-four oder Ray Bradburys Fahrenheit 451, über Logan’s Run und The Matrix bis zu Young Adult Dystopias wie den Hunger-Games- und Maze-Runner-Reihen.2
Der Befund scheint somit klar: Düstere Entwürfe en masse, aber weit und breit keine positive Alternative. So eindeutig dieses Fazit scheint, es stimmt nur zum Teil. Im Spielfilm sind positive Utopien tatsächlich weitgehend inexistent. Ganz anders sieht es dagegen aus, wenn man das Terrain wechselt und sich in nicht fiktionalen Gefilden, beim Dokumentarund Propagandafilm umschaut. Hier gibt es Visionen einer besseren Welt sonder Zahl. Viele dieser Filme sind obskur, und kaum einer ist als Utopie deklariert, den Morus’schen Geist atmen sie dennoch. Beispielsweise der zionistische Propagandafilm Land of Promise von Juda Leman. Dieser Film aus dem Jahre 1935, der erste in Palästina produzierte Tonfilm, zeigt während knapp einer Stunde, wie die jüdischen Einwanderer das karge Wüstenland urbar machen, wie im damaligen britischen Mandatsgebiet ein modernes Gemein wesen entsteht, in dem die Juden vor Verfolgung sicher sind. Land of Promise ist ein für seine Zeit typischer Propagandafilm mit schnarrendem Offkommentar und stereotypen Bildern von marschierenden Arbeitern und modernen landwirtschaftlichen Maschinen, wie man sie aus unzähligen ähnlichen Produktionen kennt. Manches, was der Film zeigt, ist aus heutiger Sicht durchaus problematisch. So wird die arabische Bevölkerung in freundlich herablassender Art als rückständiges Kuriosum inszeniert. Nichtsdestotrotz wohnt dem Film ein utopischer Impuls inne – das titelgebende Land der Verheissung ist im Entstehen, und jeder Jude guten Willens kann sich an seinem Aufbau beteiligen.
Dass Propagandafilme oft eine Nähe zur Utopie besitzen, ist nicht erstaunlich, denn beiden Formen geht es letztlich darum, das Publikum von ihrer Vorstellung, wie eine Gesellschaft organisiert sein soll, zu überzeugen. So wurden in den USA während des Zweiten Weltkriegs zahlreiche Filme produziert, die der Bevölkerung in den befreiten Ländern Europas den American Way näherbringen sollten. Einen besonderen Nachgeschmack hinterlässt angesichts der jüngsten Ereignisse in den USA John Housemans Tuesday in November, der die Präsidentschaftswahl in einer amerikanischen Kleinstadt zeigt und in sehr didaktischer Weise das politische System der USA erklärt. Das ist trockene Materie, weshalb der Film auch versucht, dem Ganzen eine emotionale Komponente zu geben, indem er die Harmonie betont, in der die Wahl abläuft. Die Gegenwart wird als Idealzustand inszeniert, als bereits realisierte Utopie. Es mag politische Differenzen geben, aber am Ende sind alle im Vertrauen in das demokratische System vereint. Utopische Zustände in der Tat!
Seit dem 19. Jahrhundert, mit dem Einsetzen der industriellen Revolution, tendiert die Utopie immer mehr in Richtung Science Fiction. Waren die frühen Utopien noch in der Gegenwart angesiedelt, meist auf abgelegenen Inseln, verlagerten sich die besseren Welten nun in die Zukunft. Damit wurden auch technische Neuerungen immer wichtiger. Technikutopien, die die wunderbare automatisierte Welt von morgen zeigen, gibt es in der Filmgeschichte ebenfalls schon früh. So produzierte General Motors anlässlich der New Yorker Weltausstellung von 1939 To New Horizons. Der Kurzfilm basiert auf GMs Futurama-Exponat, das zu den Publikumsmagneten der Ausstellung gehörte. Ein riesiges und sehr detailliertes Modell führt dem staunenden Publikum die Welt von morgen vor, deren Hauptattraktion ein automatisiertes Schnellstrassennetz ist. Nach einem kurzen Prolog, der die Strasse als zentrales visuelles Motiv etabliert, schwelgt der Film in Detailaufnahmen des Futurama-Modells mit seinen Autobahnbrücken, Fabriken und einem Hightech- Flughafen. Der Film ist insofern prophetisch, als er die Stadt der Zukunft als grosse Suburbia zeigt. Dank dem Highway-System kann jeder schnell von seinem Haus im Grünen zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren.
Vorstellungen der Zukunft sind immer ein Spiegel ihrer Entstehung und damit historisch höchst wandelbar. Zwei Ereignisse, die für die kollektive Imagination der US-Bevölkerung von besonderer Wichtigkeit waren, sind die Weltausstellungen 1939 und 1965 in New York. Letztere ist so etwas wie ein Kulminationspunkt des Fortschrittsoptimismus im 20. Jahrhundert. Die Mittelschicht genoss unbeschwert ihren neuen Wohlstand, der Mond war bereits zum Greifen nahe, der Vietnamkrieg zwar schon im Gange, aber noch nicht wirklich präsent. Für diese Weltausstellung produzierte GM erneut einen filmischen Blick in die Zukunft. Entgegen seinem Titel gibt sich Out of this World aber ziemlich diesseitig. Zu Beginn sind noch kurz Science-Fiction-Szenerien wie Siedlungen am Südpol und auf dem Meeresgrund zu sehen, schnell wendet sich der Film aber dem trauten Heim zu und zeigt die automatisierte Küche von morgen, die insbesondere die Frau des Hauses in Entzücken versetzt. Dass sich ein Werbefilm eines Autokonzerns politisch zurückhaltend gibt und keine radikal neue Gesellschaftsform entwirft, kann nicht überraschen. Es ist aber dennoch frappierend, wie konservativ dieser vermeintliche Blick nach vorne ist. Zwar wird es dereinst einen Ofen geben, in dem ein Braten nur wenige Minuten braucht, um gar zu werden, was gleich bleibt, ist, dass dieser Ofen von einer Frau bedient wird.
Im Kontext der Weltausstellungseuphorie ist auch The Florida Project anzusiedeln, der letzte Film Walt Disneys, den dieser wenige Monate vor seinem Tod drehte. Für alle, die mit dem Namen Disney primär familientaugliche Unterhaltung assoziieren, dürfte der knapp 25-minütige Promotionsfilm eine Überraschung sein. Der «Herr der Mäuse» spricht darin über sein neustes und ambitioniertestes Projekt – Disney World. Für einmal geht es aber nicht um Zauberschlösser, Achterbahnen und Merchandising, Herz der geplanten Anlage soll vielmehr eine technische Musterstadt der Zukunft sein: die «Experimental Prototype City of Tomorrow», kurz EPCOT.3
EPCOT, das mit dem heute existierenden Themenpark nur den Namen gemein hat, war nicht als Jahrmarktsattraktion gedacht, sondern als echte Stadt, in der 20 000 Menschen wohnen und arbeiten und so die Zukunft quasi vorleben sollten. Mit Unterstützung der gesamten amerikanischen Industrie wollte Disney ein lebendiges Stadtlaboratorium mit Wohn-, Arbeitsund Konsumbezirken, unterirdischen Highways und einem ausgeklügelten öffentlichen Verkehrssystem aus dem Boden stampfen. Disney sah darin seinen Beitrag zu der in seinen Augen grössten gesellschaftlichen Herausforderung der Gegenwart, dem, wie er es nennt, «Problem unserer Städte». Hinter dieser Formulierung verbergen sich so unterschiedliche Dinge wie Verkehrsprobleme, gesellschaftliche Spannungen, Kriminalität und Rassenunruhen. Dass Disney die Dinge nicht beim Namen nennt, ist bezeichnend. Der Studiomogul war auf seine Art durchaus ein Utopist. In seinem Utopismus verschränkt sich die Begeisterung für technische Neuerungen aber auf eigentümliche Weise mit sozialer Rückwärtsgewandtheit. Seine Lösung für das «Problem der Städte» ist denn auch eine rein technokratische; Klassenunterschiede und gesellschaftliche Spannungen werden zur reinen Ingenieursaufgabe.
Obwohl EPCOT weit mehr hätte werden sollen als bloss ein Themenpark, ist Disneys Vision vollständig von einer Disneylandlogik durchdrungen. Augenfällig wird das schon im Auftakt des Films, der den Vergnügungsparks in Kalifornien zeigt und im Offkommentar den reibungslosen Transport der Be suchermassen betont. Der Tenor ist eindeutig: Bei Disney weiss man, wie man eine funktionierende Stadt baut, in der sich alle wohlfühlen; ob Vergnügungspark oder echte Stadt ist da einerlei. Die Stadt als Mechanismus, in den sich die Bewohner möglichst reibungslos einfügen, das ist im Grunde gar nicht so weit weg von Morus’ Utopia.
Aus einer ganz anderen Ecke kommt ein Film, der zwischenzeitlich zu einem regelrechten Onlinephänomen avancierte. Zeitgeist: Addendum des unter Pseudonym agierenden Regisseurs Peter Joseph ist der zweite von insgesamt drei Zeitgeist-Filmen. Die frei im Web verfügbaren Low-Budget-Produktionen sind ein wildes Gemisch unterschiedlicher Verschwörungstheorien: Dunkle Mächte, die auf einen Weltstaat hinarbeiten, etwa die Weltbank, der IWF und die US-Regierung, werden für alle Übel der Welt verantwortlich gemacht. In Zeitgeist: The Movie bleibt es bei dieser kruden Anklage. Die Fortsetzung Zeitgeist: Addendum schlägt dann einen anderen Ton an. Als eigentlicher Ursprung des allgemeinen Elends wird nun die Tatsache ausgemacht, dass unser Wirtschaftssystem auf Geld basiert. Vor allem aber wartet der Film mit einer Alternative auf – dem Venus Project.4.
Hinter dem Venus Project, benannt nach seinem Standort in Venus, Florida, stehen der 1916 geborene Autor und Erfinder Jacque Fresco und dessen Partnerin Roxanne Meadows, die seit Jahrzehnten für eine radikale gesellschaftliche Neuorganisation werben. Wie Joseph sehen auch Fresco und Meadows, die im Film ausführlich zu Wort kommen, in unserem geldbasierten Wirtschaftssystem das eigentliche Problem. Als Lösung propagieren sie ihr Konzept einer «Resource Based Economy». Wie diese funktionieren soll, bleibt zwar höchst nebulös, aber dank intelligenten Computern und der fehlenden Notwendigkeit, Profit zu erzielen, können die vorhandenen Ressourcen gleichmässig und sinnvoll verteilt werden; niemand muss mehr Hunger leiden.
Obwohl Fresco, der für sein hohes Alter noch erstaunlich rüstig ist, sich die Bezeichnung «Utopie» verbittet, übernimmt er zahlreiche Elemente direkt von Morus. Seine alternative Gesellschaft zeichnet sich wie schon die von Utopia durch Rationalität, Kollektivismus, Geldlosigkeit und eine radikale Reduzierung der Gesetze aus. Neu ist die zentrale Rolle, die die Technologie spielt. Das Venus Project baut wesentlich auf technische Wunderwerke wie Einschienenbahnen, kreisförmige Städte, futuristische Fluggeräte und Kraftwerke, die saubere Energie produzieren. All dies ist im Film auch zu sehen. Die Skizzen und Modelle Frescos, deren Futurismus mittlerweile ziemlich angestaubt wirkt, sind die eigentlichen Schauwerte des Films.
Die Zeitgeist-Filme stiessen Ende der ersten Dekade dieses Jahrhunderts auf ein riesiges Echo, man geht mittlerweile von deutlich über 200 Millionen «views» aus. Das Interesse war so gross, dass sich eine eigene Bewegung, das Zeitgeist Movement, bildete, das sich zu Beginn als aktivistischer Arm des Venus Project verstand und mit verschiedenen Aktionen – auch im Kontext der Occupy-Bewegung – auf sich aufmerksam machte. Mittlerweile ist die Begeisterung deutlich abgeflaut; Venus Project und Zeitgeist Movement haben sich, wie es bei sektenartigen Vereinigungen oft vorkommt, überworfen und sprechen nicht mehr miteinander. Beide Organisationen existieren aber nach wie vor, wenn auch Teile ihrer Webpräsenz etwas verwaist wirken.
Was die bislang genannten Beispiele verbindet und die klassische Utopie insgesamt kennzeichnet, ist der didaktisch-autoritäre Ansatz. Wir als Zuschauer werden von einer Instanz angesprochen, die weiss, was für uns gut ist. Dass wir selbst etwas beitragen, ist nicht vorgesehen. Hier setzt Demain, der dokumentarische Grosserfolg des vergangenen Jahres, an. Ausgangspunkt ist wie so oft die Feststellung, dass heute vieles – zu vieles – im Argen liegt. Anstatt diesen Umstand wort- und bildreich zu beklagen oder den Ursachen nachzugehen, suchen die Filmemacher aber lieber nach einem Ausweg. Kreuz und quer reisen sie durch die Welt auf der Suche nach Lösungen, die bereits existieren. Seien es ein Urban-Gardening-Projekt in Detroit, erneuerbare Energie auf La Réunion, die Förderung von Veloverkehr in Kopenhagen, Schulen ohne Hausaufgaben in Finnland oder lokale Miniwährungen in England – mit David-Bowie-Banknoten! –, taugliche Lösungen gibt es allenthalben.
In der Anlage ähnelt Demain Michael Moores im gleichen Jahr in den Kinos gestarteten Where to Invade Next. In seinem Film verlässt Moore die Dystopie USA und macht sich im Ausland, vor allem in Europa, auf die Suche nach Alternativen. Denn die Utopie – lange Ferien in Italien, reichhaltige Schulverpflegung in Frankreich und einmal mehr das finnische Schulsystem – ist auch hier bereits Realität, man muss sie nur suchen.
Was Demain bei aller Ähnlichkeit gegenüber Where to Invade Next auszeichnet, ist seine Energie. Das Raffinierte am Film von Cyril Dion und Mélanie Laurent ist, dass es letztlich gar nicht darauf ankommt, ob man die einzelnen präsentierten Projekte tatsächlich für sinnvoll hält. Entscheidend ist die ansteckende Begeisterung, mit der die Filmemacher ihre Suche nach utopischen Enklaven in der Gegenwart inszenieren. Statt das allgemeine Elend zu beklagen oder in Resignation zu versinken, versprüht Demain Optimismus. Der Film ist im besten Sinn agitatorisch; man verlässt das Kino energiegeladen und mit dem Wunsch, die Welt zu verändern. Wie ansteckend diese Begeisterung ist, zeigt der enorme Erfolg des Films; in Frankreich zog Demain über eine Million Zuschauer an, in der Schweiz waren es fast 150 000. Ob dem Enthusiasmus Taten folgen oder ob es bloss beim guten Gefühl bleibt, wird sich freilich zeigen müssen.
Man kann den Optimismus von Demain als naiv abtun, doch damit wird man dem Film nicht gerecht. Die Naivität des Films ist nicht dümmlich, sondern es ist vielmehr jene Art von unschuldiger Begeisterung, die jeden auszeichnet, der etwas auf die Beine stellen will, sei das nun der Gründer eines Start-up-Unternehmens, eine Künstlerin oder ein politischer Aktivist. Es ist die Überzeugung, dass es trotz Hindernissen möglich ist, etwas zu bewirken. Das ist Utopie in Reinkultur, es ist jener Impuls, den der Philosoph Ernst Bloch als «Prinzip Hoffnung» bezeichnet und der in seinen Augen jeglichem menschlichen Streben zugrunde liegt. Ob das wirklich zutrifft, ob dem Prinzip Hoffnung nicht ein mindestens so wirkungsmächtiges Prinzip Missgunst gegenübersteht, ist angesichts der jüngsten politischen Ereignisse zwar keineswegs ausgemacht. Dass die Gegenwart trotz allem viel utopisches Potenzial bereithält, ist in Zeiten politischer Düsternis aber sicher nicht die schlechteste Botschaft.
Gestern Abend fand an der Universität Paderborn ein Symposium zu Ehren von Richard Saage statt (s. den letzten Beitrag). Die Veranstaltung stand unter dem Titel «500 Jahre Utopia». Für mich bot der schöne Anlass nicht nur die Gelegenheit, bereits bekannte utopische Mitstreiter wie Peter Seyferth oder Susanna Layh wiederzusehen, sondern auch einige wichtige Vertreter der Utopieforschung, die ich bislang nur lesenderweise kannte, endlich einmal in Fleisch und Blut zu treffen. Neben dem Jubilar waren das u. a. Thomas Schölderle und Hans Ulrich Seeber. Die beiden stehen zwar für zwei Generationen der Utopieforschung und kommen aus unterschiedlichen Disziplinen – Schölderle ist Politologe, Seeber Literaturwissenschafler –, beide sind für mich aber wichtige Referenzen in meinem Forschungsprojekt.
Ich selbst durfte an der Veranstaltung einen Vortrag halten (s. Film; der Ton ist etwas leise), ich sprach – natürlich – über mein Forschungsprojekt zur Utopie im nichtfiktionalen Film. Ich habe diesen Vortrag bereits in verschiedenen Fassungen vor ganz unterschiedlichen Zuschauergruppen gehalten – mit keineswegs immer dem gleichem Erfolg. Somit war ich durchaus gespannt, wie er in diesem Rahmen, just vor den Leuten, auf die ich mich fortlaufend beziehe, ankommen würde. Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es war nicht nur sehr angenehm, dass ich für einmal nicht erklären musste, was ich unter einer klassischen Utopie verstehe, auch sonst waren die Reaktionen sehr ermutigend.
Wer sich im deutschsprachigen Raum mit dem Thema Utopie beschäftigt, wird früher oder später – wahrscheinlich eher früher – auf den Namen Richard Saage stossen. Der Politologe hat zahlreiche Publikationen zum Thema veröffentlicht, unter anderem die vierbändigen Utopischen Profile, die wohl umfassendste Darstellung utopischer Entwürfe in deutscher Sprache. Daneben hat Saage noch diverse Monographien und eine schier unüberschaubare Zahl von Aufsätzen zur Utopie und anverwandten Bereichen verfasst. Bekannt wurde er nicht zuletzt für seine Forderung, dass die Utopieforschung von einem klassischen, an Thomas Morus’ Utopia orientierten Begriff ausgehen sollte. Diesem Ansatz folge auch ich in meinem Forschungsprojekt, wobei ich mich an dem vom Saage-Schüler Thomas Schölderle in dessen Dissertation Utopia und Utopie entwickelten Modell orientiere.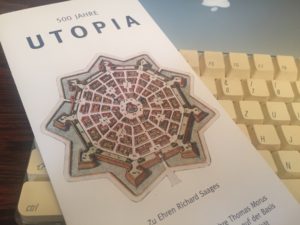
Aus Anlass von Saages 75. Geburtstag findet diesen Mittwoch an der Universität Paderborn das Symposium 500 Jahre Utopia statt. Zu meiner grossen Freude gehöre ich zu den Rednern, die an der Veranstaltung dem Jubilar die Ehre erweisen dürfen. Ich freue mich sehr auf den Anlass, nicht zuletzt, weil ich Saage sowie eine Reihe weiterer Kollegen, die ich bislang nur lesenderweise kannte, dort nun erstmals persönlich treffen werde.
Dass im Kino Dystopien derzeit überaus beliebt sind, positive Entwürfe dagegen Mangelware bleiben, wird oft damit erklärt, dass das Medium Film hier lediglich als Spiegel der aktuellen politischen Misere fungiere. Wie ich an dieser Stelle schon mehrfach ausgeführt habe, halte ich diese These für weniger überzeugend;1 die Popularität von Dystopien hat in meinen Augen andere Gründe. Was sich allerdings nicht abstreiten lässt, ist, dass die Welt seit letzter Woche deutlich dystopischer geworden ist. So dystopisch, dass ich mich ausnahmsweise zu einem tagespolitischen Kommentar genötigt fühle.
Zu Trump selbst möchte ich hier nicht viel schreiben. Dass seine Wahl eine Katastrophe ist und dass sich die USA auf eine gesellschaftspolitische Eiszeit gefasst machen können, in der es Minderheiten aller Art noch schwieriger haben dürften, während rassistische Gruppierungen fröhliche Urständ feiern, sollte jedem denkenden Wesen klar sein. Was Trumps Wahl aussenpolitisch bedeutet, ist zwar schwer abzuschätzen, Gutes ist von ihm aber kaum zu erwarten. Noch übler ist freilich, dass Trump selbst wahrscheinlich das kleinere Problem ist im Vergleich zu dem Gruselkabinett, das er um sich herum versammelt hat.
Thema dieses Eintrags soll aber nicht Trump sein, sondern die ziemlich absurde Diskussion über reale und vermeintliche Eliten, die mit seiner Wahl eingesetzt hat. Überall lesen wir nun, dass in dieser Wahl ein anti-elitärer Impuls sichtbar wurde. Die Eliten sind in ihren Blasen (Elfenbeintürme sind nicht mehr in) derart abgekapselt, dass sie den Kontakt mit dem einfachen Wahlvolk verloren haben und deshalb nicht kommen sahen, was kommen musste. Dieser Schluss zieht sich quer durch die Medien und die politischen Lager, Nassim Nicholas Taleb und Adrian Daub vertreten ihn ebenso wie Rudolf Strahm oder Bernie Sanders (s. Clip). Der Tenor ist eindeutig: Die Elite muss sich wieder den Sorgen des kleinen Mannes (nicht so sehr jener der kleinen Frau) zuwenden. Aber nichts dergleichen geschieht, die Elite zeigt sich vielmehr borniert, die Intellektuellen wollen einfach nicht verstehen.
An dieser Interpretation scheint mir nur etwas korrekt: Ich habe in der Tat Mühe zu verstehen, warum «Joe Sixpack from Main Street» von der Mauer an der Grenze zu Mexiko mehr profitieren soll als von der Anhebung des Mindestlohns, wie Clinton ihn gefordert hat. Aber wahrscheinlich liegt das eben daran, dass ich ein elitärer Sack bin. Ansonsten ist an dem Befund so ziemlich alles falsch, nicht zuletzt, dass mit dem magischen Wort «Elite» wahlweise sehr unterschiedliche Dinge bezeichnet werden. Mal ist damit das demokratische Establishment um Clinton gemeint, dann wieder die Führungsriege der Republikaner, mal die genderistisch-feministische Weltverschwörung, mal Demoskopen, dann wieder einfach die da oben oder auch schlicht Intellektuelle jeder Couleur. Peter Schneider trifft es mit seiner Feststellung: «Die bösen Eliten sind immer andere.»
Obwohl der anti-elitäre Reflex nun allerseits als Erklärung rumgereicht wird, scheint mir dieser als Hauptgrund für den Wahlausgang nicht sonderlich plausibel. Damit will ich keineswegs abstreiten, dass es diese anti-elitäre Haltung gibt und dass sie in den USA mancherorts noch ausgeprägter ist als in unseren Breitengraden. Wofür ich aber wenig Anhaltspunkte sehe, ist, dass es sich hierbei um eine Neuerscheinung handelt. Vor allem deutet wenig darauf hin, dass es tatsächlich ein neuartiger anti-elitärer Furor war, der zum Wahlergebnis geführt hat. Die folgende Graphik welche die Wahlergebnisse der letzte drei Präsidenschaftswahlen in absoluten Zahlen darstellt, ist diesbezüglich sehr erhellend:2
Etwas springt bei dieser Zusammenstellung ins Auge: Nicht nur hat Clinton Trump in absoluten Zahlen geschlagen, dieser hat insgesamt kein sonderlich überragendes Ergebnis eingefahren. Trump macht rund 300’000 Stimmen mehr als Mitt Romney vor vier Jahren und etwas über 1,3 Millionen mehr als McCain 2012; zweifellos eine Steigerung, aber keine dramatische. Ganz anders sieht es bei Clinton aus: Sie hat massiv schlechter abgeschnitten als Obama 2008 (sieben Millionen Stimmen Differenz) und immer noch deutlich schlechter als dieser 2012 (fast 3,5 Millionen weniger). Auf den Punkt gebracht heisst dass, dass es nicht Trump war, der die Wahl glorios gewonnen hat. Vielmehr hat Clinton im Vergleich zu Obama deutlich verloren.
Das Gerede vom Aufschrei der durch Political Correctness und andere Bevormundung gegängelten weissen Mittelschicht verliert dadurch einiges an Plausibilität. Trump gelang es ganz offensichtlich nicht, im grossen Stil neue Wählerschichten anzusprechen, er konnte im Wesentlichen jene Gruppen halten, die auch schon früher republikanisch wählten. Das Ergebnis zeigt deutlich, dass die über drei Millionen Wähler, die Clinton gegenüber Obama eingebüsst hat, nicht ins Trump-Lager wechselten. Es gab keinen Massenexodus von der elitären Clinton zum anti-elitären Trump. Es sieht vielmehr danach aus, als seien viele potenzielle Clinton-Wähler der Urne einfach ferngeblieben.3
Zweifellos ist dieser Befund wenig schmeichelhaft für Clinton; die anti-elitäre Dynamik, die Horden wütender weisser Wähler (was für eine schöne W-Alliteration!), die allerorten beschrieben werden, sind aber eine Illusion oder zumindest nichts Neues. Einen spürbaren Einfluss auf Trumps Ergebnis hatten sie nicht. Oder noch einmal anders: Wenn diese Dynamik tatsächlich wirksam war, dann primär negativ – als Abstrafung der «abgehobenen Insiderin» Clinton. Hätte sie sich positiv auf den Aussenseiter Trump ausgewirkt, hätte dieser in absoluten Zahlen ein deutlich besseres Ergebnis erreicht.
Clinton war offensichtlich die falsche Kandidatin, ihr Image zu schlecht, um Trump zu schlagen (dass hier Sexismus eine zentrale Rolle gespielt haben dürfte, sei nur am Rande erwähnt). Die These von der neu erwachten anti-elitären Bewegung, ist dagegen Unsinn. Trump konnte auf das republikanische Lager zählen und hatte zudem das Glück, dass ihm eine äusserst unpopuläre Opponentin gegenüberstand. Für beide Seiten dürfte aber wohl gelten, dass ein/e weniger umstrittene/r Gegenspieler/in für ein viel deutlicheres Ergebnis gesorgt hätte.
Die Eigenheiten des Elektorensystem sorgen dafür, dass es für Clinton gereicht hätte, wenn sie nur an ein paar entscheidenden Orten mehr Wähler an die Urne gebracht hätte. Dann würden wir heute ganz andere Wahlanalysen lesen: Von einer schallende Ohrfeige für Demagogen wäre dann die Rede und davon, dass die Amerikaner eigentlich grundanständig seien und es für den Trump’schen Rassismus in den USA keinen Platz gibt etc.
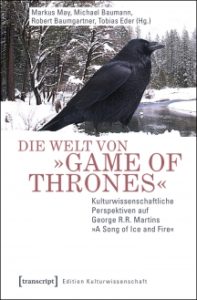 Mit Fantasy habe ich eigentlich wenig am Hut. Lord of the Rings habe ich vor Jahren gelesen, ohne dass es grossen Eindruck auf mich gemacht hätte, Harry Potter hat mich nach dem dritten Band nicht mehr sonderlich interessiert, und die neueren Fantasy-Blockbuster schaue ich mir – wenn überhaupt – eher aus Pflichtgefühl, denn aus genuinem Interesse an. Eine grosse Ausnahme bildet aber die Fernsehserie Game of Thrones, die mich restlos begeistert (ok, nicht völlig restlos. Staffel 5 und 6 konnten nicht ganz an die vorangegangenen Höhepunkte anschliessen).
Mit Fantasy habe ich eigentlich wenig am Hut. Lord of the Rings habe ich vor Jahren gelesen, ohne dass es grossen Eindruck auf mich gemacht hätte, Harry Potter hat mich nach dem dritten Band nicht mehr sonderlich interessiert, und die neueren Fantasy-Blockbuster schaue ich mir – wenn überhaupt – eher aus Pflichtgefühl, denn aus genuinem Interesse an. Eine grosse Ausnahme bildet aber die Fernsehserie Game of Thrones, die mich restlos begeistert (ok, nicht völlig restlos. Staffel 5 und 6 konnten nicht ganz an die vorangegangenen Höhepunkte anschliessen).
Deshalb habe ich auch nicht lange gezögert, als mich Markus May letztes Jahr anfragte, an der von ihm organisierten Tagung zu Game of Thrones resp. zu Songs of Ice and Fire teilzunehmen (ich habe hier schon früher geschrieben). Nun ist, ungewöhnlich schnell und quasi passend zum Fernsehinterview, das ich kürzlich gegeben habe, der Tagungsband erschienen. Ich bin darin mit einem Artikel zur erzählerischen Funktion der Sexszenen in GoT vertreten. Dazu ein Zitat aus der Einleitung:
Simon Spiegel untersucht in »›Everything in the world is about sex, except sex. Sex is about power.‹ Die Funktion der Sexpositions in GOT« die sowohl für Fern-sehverhältnisse wie auch die filmische Fantasy ungewohnt expliziten Sexszenen von GOT anhand des von Myles McNutt geprägten, in der Diskussion von GOT inzwischen etablierten Begriffs der Sexposition. Spiegel lokalisiert den Begriff im Rahmen des Quality TV-Diskurses, nutzt ihn für eine detaillierte Analyse der Sexszenen von GOT und zeigt, dass deren Funktion in der Serie die Sexposition als voyeuristische Informationsquelle weit überschreitet.
Update: Der Artikel ist mittlerweile online verfügbar.
Markus May / Michael Baumann / Robert Baumgartner / Tobias Eder (Hg.): Die Welt von »Game of Thrones«. Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf George R.R. Martins »A Song of Ice and Fire«. Transcript: Bielefeld 2015
400 Seiten, ISBN 978-3837637007, 29,99.– €.
Erhältlich bei Amazon.
Bei der Emmy-Verleihung vergangenen Sonntag hat Game of Thrones mal wieder abgeräumt; die Serie bringt es mittlerweile auf 38 Emmys, was in anscheinend einen Rekord in der Geschichte des Fernsehen darstellt. Für die Nachrichtensendung 10vor10 war der Preissegen Anlass für einen kurzen Nachrichtenbeitrag, bei dem auch meine Wenigkeit zu Wort kommen durfte (allerdings in unserer Schweizer Geheimsprache).
Spät kommt sie, aber sie kommt. Rechtzeitig vor der GFF-Jahrestagung in Münster sollte dieser Tage die neue Ausgabe der Zeitschrift für Fantastikforschung bei den Abonnenten eintrudeln. Eigentlich hätte sie schon vor mehreren Monaten erscheinen sollen, aus verschiedenen Gründen hat sich die ganze Sache aber leider verzögert.
Neben rund 60 Seiten mit Rezensionen aktueller wissenschaftlicher Literatur bietet die Ausgabe viel Material für alle, die am SF-Kino interessiert sind. Joerg Hartmann leistet in seinem Artikel «‹An absolutely fascinating period piece …›» Grundlagenforschung. Hartmann ist im Rahmen seines Forschungsprojekts, in dem es eigentlich um die Metapher des Raumflugs geht, über Anton Kutters Kurzfilm Weltraumschiff 1 startet – Eine technische Fantasie aus dem Jahr 1936 gestolpert. Kutter war nicht nur Filmemacher, der nach ersten Erfolgen unter den Nazis in Ungnade fiel, sondern auch ein begeisterter Hobby-Astronom. Sein Film (auf YouTube verfügbar, s. unten) ist ein aus heutiger Sicht seltsamer Hybrid aus Fiktion- und Nichtfiktion mit durchaus sehenswerten Spezialeffekten. Über diesen halb vergessenen Film war bislang wenig Gesichertes bekannt; Hartmann hat sich in Archive begeben sowie Kutters Sohn Adrian ausfindig gemacht und kann nun erstmals die Entstehung dieses filmhistorischen Kuriosums dokumentieren.
Szilvia Gellai widmet sich in ihrem Artikel ebenfalls dem deutschen SF-Kino und zwar Rainer Werner Fassbinders Welt am Draht von 1973. Fassbinders Verfilmung von Daniel F. Galouyes Roman Simulacron-3 aus dem Jahr 1964 ist zwar deutlich weniger obskur als Weltraumschiff 1 startet, da der Film aber lange nicht greifbar war, umwehte in während Jahren ein Hauch des Legendären. Welt am Draht ist eine Art Matrix avant la lettre und spielt in einer Welt, in der eine perfekte Computersimulation existiert, deren ‹Bewohner› nicht wissen, dass sie bloss Programme sind. Natürlich stellt sich je länger je mehr die Frage, ob denn die vermeintliche «Basiswelt» nicht ihrerseits ebenfalls eine Simulation ist. Gellai rückt den Moment des Conceptula Breakthrough, also die schlagartige Einsicht, dass die Welt ganz anders beschaffen ist als bisher gedacht, ins Zentrum ihrer Überlegungen und arbeitet zahlreiche Parallelen zwischen Fassbinders Film und Sigmund Freuds tiefenpsychologischem Modell heraus.
 Als ich vor gut zehn Jahren meine Dissertation Die Konstitution des Wunderbaren schrieb, konnte ich in der Einleitung noch guten Gewissens festhalten, dass kaum wissenschaftliche Studien zum SF-Fandom existieren würden. Das hat sich mittlerweile drastisch geändert, die Fan Studies gehören seit einigen Jahren zu den boomenden Feldern innerhalb der Fantastikforschung. Matthias Völckers Beitrag ist hierfür ein Beispiel. Völcker präsentiert in seinem Artikel «‹Du bist einfach nur ein absoluter Freak›» die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, in deren Rahmen er 25 Interviews mit Star-Wars-Fans im Alter von sieben bis 46 Jahren geführt hat. Obwohl sich die interviewten Fans in Alter, Geschlecht und Interessen – einige der jüngeren Fans haben die Star-Wars-Filme noch gar nicht gesehen – unterscheiden, gibt es auch zahlreiche Gemeinsamkeiten. So beschreiben alle Interviewten eine Art Initiationserlebnis, das sie zum Fan machte; für alle ist Star Wars ein identitätsstiftender Gegenstand, der Teil ihres eigenen Selbstverständnisses ist.
Als ich vor gut zehn Jahren meine Dissertation Die Konstitution des Wunderbaren schrieb, konnte ich in der Einleitung noch guten Gewissens festhalten, dass kaum wissenschaftliche Studien zum SF-Fandom existieren würden. Das hat sich mittlerweile drastisch geändert, die Fan Studies gehören seit einigen Jahren zu den boomenden Feldern innerhalb der Fantastikforschung. Matthias Völckers Beitrag ist hierfür ein Beispiel. Völcker präsentiert in seinem Artikel «‹Du bist einfach nur ein absoluter Freak›» die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, in deren Rahmen er 25 Interviews mit Star-Wars-Fans im Alter von sieben bis 46 Jahren geführt hat. Obwohl sich die interviewten Fans in Alter, Geschlecht und Interessen – einige der jüngeren Fans haben die Star-Wars-Filme noch gar nicht gesehen – unterscheiden, gibt es auch zahlreiche Gemeinsamkeiten. So beschreiben alle Interviewten eine Art Initiationserlebnis, das sie zum Fan machte; für alle ist Star Wars ein identitätsstiftender Gegenstand, der Teil ihres eigenen Selbstverständnisses ist.
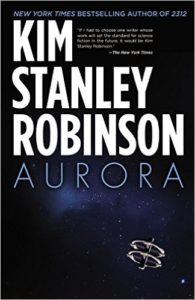 In meinem eigenen Beitrag beschäftige ich mich für einmal nicht mit Film. Vielmehr widme ich Aurora, dem jüngsten Roman des von mir hoch geschätzten Kim Stanley Robinson. In Aurora, der in SF-Kreisen für einigen Wirbel gesorgt hat, erteilt Robinson der Idee, dass der Mensch in absehbarer Zeit Planeten ausserhalb des Sonnensystems besiedeln könnte, eine deutliche Absage, was für manchen eingefleischten SF-Fan schon fast an ein Sakrileg grenzt.. Was mich in meinem Review Essay aber fast mehr interessiert, ist die Erzählkonstellation des Romans, denn als Erzähler fungiert in Aurora das Raumschiff, mit dem die Menschen zum titelgebenden Mond Aurora unterwegs sind. Ergänzt werden meine Überlegungen durch ein Interview mit Robinson, der sich wie immer als äusserst reflektierter Zeitgenosse erweist und über die teilweise heftigen Reaktionen keineswegs überrascht war: «Ich hätte etwas falsch gemacht, wenn es nicht zu entsprechenden Reaktionen gekommen wäre» (S. 88).
In meinem eigenen Beitrag beschäftige ich mich für einmal nicht mit Film. Vielmehr widme ich Aurora, dem jüngsten Roman des von mir hoch geschätzten Kim Stanley Robinson. In Aurora, der in SF-Kreisen für einigen Wirbel gesorgt hat, erteilt Robinson der Idee, dass der Mensch in absehbarer Zeit Planeten ausserhalb des Sonnensystems besiedeln könnte, eine deutliche Absage, was für manchen eingefleischten SF-Fan schon fast an ein Sakrileg grenzt.. Was mich in meinem Review Essay aber fast mehr interessiert, ist die Erzählkonstellation des Romans, denn als Erzähler fungiert in Aurora das Raumschiff, mit dem die Menschen zum titelgebenden Mond Aurora unterwegs sind. Ergänzt werden meine Überlegungen durch ein Interview mit Robinson, der sich wie immer als äusserst reflektierter Zeitgenosse erweist und über die teilweise heftigen Reaktionen keineswegs überrascht war: «Ich hätte etwas falsch gemacht, wenn es nicht zu entsprechenden Reaktionen gekommen wäre» (S. 88).
Das Inhaltsverzeichnis zum Download.