Nächste Woche findet in Berlin die Tagung Embattled Heavens: The Militarization of Space in Science, Fiction, and Politics statt, an der ich einen Vortrag halten werde – natürlich zur Utopie. Das Thema der Tagung ist zwar nicht unbedingt utopisch, ich habe es aber dennoch geschafft, mich reinzuschmuggeln, und zwar mit einem Vortrag zu Robert A. Heinleins Starship Troopers (1959). Der Roman erzählt die Geschichte des jungen Soldaten Johnnie Rico, der in der Zukunft gegen ausserirdische Bugs kämpft. Wie diese Zukunft im Detail aussieht, wie die Gesellschaft organisiert ist, erfahren wir kaum, lediglich ein Aspekt wird hervorgehoben: Wahlberechtigt ist in der Welt von Starship Troopers nur, wer Militärdienst geleistet hat.1
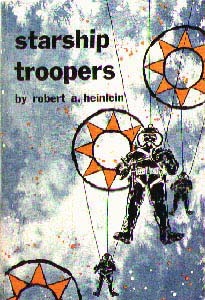 Starship Troopers ist eines der bekanntesten Büchern Heinleins und zugleich sein umstrittenstes. Wem es langweilig ist, braucht nur in einem SF-Forum seiner Wahl eine Diskussion zum Thema «Ist Starship Troopers faschistisch?» zu starten – genug Unterhaltung für die folgenden Tage dürfte garantiert sein. So ganz konnte und kann ich diese heftigen Reaktionen nie nachvollziehen, denn in meinen Augen ist der Roman nicht nur ziemlich dumm, sondern auch erstaunlich langweilig. Vorderhand wird zwar die Geschichte Johnnie Ricos erzählt, im Grund fehlt aber ein echter Plot. Stattdessen gibt es – nach einem durchaus rasenten Auftakt mit einer Schlachtenszene – kapitellange Ausführungen über militärische Ausbildung, kindische Rechtfertigungen von Todesstrafe und körperlicher Züchtigung und viel militaristisches Macho-Geschwätz.
Starship Troopers ist eines der bekanntesten Büchern Heinleins und zugleich sein umstrittenstes. Wem es langweilig ist, braucht nur in einem SF-Forum seiner Wahl eine Diskussion zum Thema «Ist Starship Troopers faschistisch?» zu starten – genug Unterhaltung für die folgenden Tage dürfte garantiert sein. So ganz konnte und kann ich diese heftigen Reaktionen nie nachvollziehen, denn in meinen Augen ist der Roman nicht nur ziemlich dumm, sondern auch erstaunlich langweilig. Vorderhand wird zwar die Geschichte Johnnie Ricos erzählt, im Grund fehlt aber ein echter Plot. Stattdessen gibt es – nach einem durchaus rasenten Auftakt mit einer Schlachtenszene – kapitellange Ausführungen über militärische Ausbildung, kindische Rechtfertigungen von Todesstrafe und körperlicher Züchtigung und viel militaristisches Macho-Geschwätz.
Dennoch beschäftigt mich der Roman schon länger, nicht zuletzt wegen Paul Verhoevens grossartiger Verfilmung. Denn Verhoeven und sein Drehbuchautor Ed Neumeier – Verhoeven selbst hat den Roman nach eigener Aussage gar nie zu Ende gelesen – haben etwas sehr ungewöhnliches gemacht, zumal für Hollywoodproduktionen: Ihr Starship Troopers ist keine Verfilmung im Geiste der Vorlage, sondern vielmehr eine Satire auf diese. Der Film nimmt die Ausgangslage des Romans und übertreibt alles ein bisschen – das Ergebnis ist eine zwar nicht sonderlich subtile, aber sehr unterhaltsame schwarze Satire.2 Eine Satire, die über die Länge eines Films hinweg funktioniert und nicht nach 30 Minuten verpufft, gehört in meinen Augen zu den schwierigsten Dingen, die es im Medium Spielfilm gibt; Starship Troopers ist eines der wenigen Beispiele, die nicht scheitern.
 Ich will schon seit geraumer Zeit einen Artikel darüber schreiben, dass Starship Troopers eigentlich eine Utopie ist. Denn zahlreiche Elemente seiner Zukunftsgesellschaft sind utopisch, und dies im doppelten Sinn: Einerseits zeigt der Film eine Gesellschaft, in der – mit Ausnahme dieses blöden Kriegs mit den Bugs – alle mehr oder weniger zufrieden scheinen, zum anderen bedient sich der Film verschiedener Topoi, die zum festen Bestandteil der utopischen Literatur gehören. An dieser Stelle sei nur ein Beispiel erwähnt: Die Klage darüber, dass die Gesetze und das Justizwesen generell zu kompliziert seien und dass vor Gericht am Ende nicht gewinnt, wer Recht hat, sondern wer den raffinierteren Anwalt aufbietet, findet sich bereits bei Morus. Viele Utopien reagieren darauf mit einer radikalen Vereinfach der Gesetze. Was richtig und falsch ist, ist ja ohnehin klar, also braucht es auch keine komplizierten Prozesse. Dieses Motiv nimmt Starship Troopers in einem seiner Nachrichten-Einsprengsel auf. So ganz nebenbei erfahren wir, dass ein Mörder am gleichen Tag vor Gericht gestellt und zu Tode verurteilt wurde. Die Exekution ist für den Abend angesetzt.
Ich will schon seit geraumer Zeit einen Artikel darüber schreiben, dass Starship Troopers eigentlich eine Utopie ist. Denn zahlreiche Elemente seiner Zukunftsgesellschaft sind utopisch, und dies im doppelten Sinn: Einerseits zeigt der Film eine Gesellschaft, in der – mit Ausnahme dieses blöden Kriegs mit den Bugs – alle mehr oder weniger zufrieden scheinen, zum anderen bedient sich der Film verschiedener Topoi, die zum festen Bestandteil der utopischen Literatur gehören. An dieser Stelle sei nur ein Beispiel erwähnt: Die Klage darüber, dass die Gesetze und das Justizwesen generell zu kompliziert seien und dass vor Gericht am Ende nicht gewinnt, wer Recht hat, sondern wer den raffinierteren Anwalt aufbietet, findet sich bereits bei Morus. Viele Utopien reagieren darauf mit einer radikalen Vereinfach der Gesetze. Was richtig und falsch ist, ist ja ohnehin klar, also braucht es auch keine komplizierten Prozesse. Dieses Motiv nimmt Starship Troopers in einem seiner Nachrichten-Einsprengsel auf. So ganz nebenbei erfahren wir, dass ein Mörder am gleichen Tag vor Gericht gestellt und zu Tode verurteilt wurde. Die Exekution ist für den Abend angesetzt.
Als Bartholomäus Figatowski vergangenes Jahr einen Call for Papers für einen Heinlein-Sammelband lancierte,3 schien das die ideale Gelegenheit, um diese Idee endlich auszuarbeiten. Um über den Film zu schreiben, musste ich mich aber zuerst genauer mit dem Roman beschäftigen, und zu meiner grossen Überraschung stellte sich heraus, dass bereits Heinleins Roman zahlreiche utopische Elemente enthält. Allerdings ist die Utopie nicht etwa die zivile Gesellschaft – denn über diese erfahren wir so gut wie nichts –, sondern die Johnnies Einheit, die Mobile Infantry.4 Am Ende erwies sich die Analyse von Starship Troopers als klassische Utopie als so ergiebig, dass ich fast ausschliesslich über den Roman schrieb und kaum noch auf Verhoevens Film eingehen konnte. Und davon wird mein Vortrag «Utopian Soldiers. Robert Heinlein’s Starship Troopers as Utopian Novel» nächste Woche handeln.
- Zur Verteidigung des Romans wird immer wieder argumentiert, dass sich der civil service keineswegs auf Militärdienst beschränken würde. Heinlein selbst vertritt diese Ansicht in Expanded Universe. Wie James Gifford, ansonsten ein grosser Bewunderer des Autors, aber nachgewiesen hat, wird diese Einschätzung durch den Roman selbst nicht gestützt. Siehe: Gifford, James: The Nature of «Federal Service» in Robert A. Heinlein’s Starship Troopers. 1996.[↩]
- Das wirft auch die Frage nach dem Verhältnis von Satire und Utopie auf. Dass die beiden Gattungen eng miteinander verbunden sind, dürfte unbestritten sein. Bislang scheint aber noch niemand diesen Zusammenhang auf grundlegender Ebene untersucht zu haben. Zumindest ist mir kein entsprechender Text bekannt.[↩]
- Das Buch sollte im Laufe des Jahres erscheinen.[↩]
- Diese Idee ist keineswegs völlig neu. Phil Gochenour hat sie in seinem Aufsatz «Utopia of Pain: Adolescent Anxiety and Narrative Ideology in Robert A. Heinlein’s Starship Troopers» bereits entwickelt. Allerdings fasse ich das Konzept der Utopie enger als Gochenour.[↩]